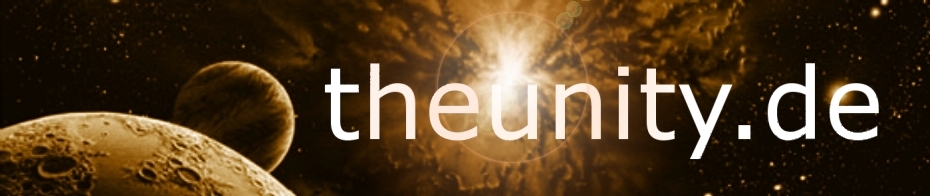dian
unregistriert
 |
|
Utopia (das alte "Unity 4")
 30.12.2008 01:19
30.12.2008 01:19 |
  |
An alle Fans von "Gegenwelt":
Lust auf eine Reise in eine Parallel-Dimension?
In eine Dimension, in der die Gegenweltler nicht Gegenweltler hießen, und statt als Bauern noch als Zirkusleute getarnt waren?
In der Janosch Gabriel hieß, und Nikita sich für den Sherrif von Nottingham hielt?
Und in der auch sonst ein paar Dinge ganz anders ablaufen?
Dann habe ich ein bisschen was zu lesen für euch...
Ich habe vorhin nach langer Zeit mal wieder das alte "Unity 4 - Utopia" durchgelesen, und neben einigem Kopfschütteln auch das eine oder andere Mal herzhaft lachen müssen.
Und ich hab mir gedacht: Diese Erfahrung sollte ich mit euch teilen.
Zur Erinnerung: "Unity 4 - Utopia" gab es vor einigen Jahren nur ganz kurz mal hier zum Runterladen. Es erschien mir nicht gut genug (was auch stimmt)... und so verschwand es recht schnell wieder in meiner Schublade.
Die meisten, die es damals gelesen haben, sind inzwischen wahrscheinlich schon von einer hohen Brücke gesprungen... 
Doch jetzt, mit etwas Abstand und dem deutlich besseren "Gegenwelt" im Rücken, ist die Zeit reif, um die alte Geschichte auszugraben und euch zur Verfügung zu stellen... und sei es auch nur zur Belustigung.
Also was erwartet euch?
Zunächst einmal sind einige Teile der Story fast originalgetreu später in "Gegenwelt" eingeflossen... (weshalb ich auch wirklich dringend empfehle, die Geschichte nur dann zu lesen, wenn ihr "Gegenwelt" bereits gelesen habt!)
Ferner bitte ich darum, zu beachten, dass dieser kleine Roman stellenweise extrem unglaubwürdig und naiv ist, und sowohl atmosphärisch als auch von der literarischen Qualität her nur in ganz seltenen Momenten "Gegenwelt"-Niveau erreicht.
Andererseits liefert es aber gerade den schriftstellerisch Interessierten unter euch ganz gutes Anschauungsmaterial darüber, wie sich Geschichten im Lauf der Zeit verändern können, und wie eine bereits bestehende Geschichte in ihre Bestandteile zerlegt und (teilweise mit anderen Charakteren) neu zusammengesetzt werden kann.
Man kann auch einfach nur grinsen und das ganze als abschreckendes Beispiel ansehen, wie man es tunlichst nicht machen sollte. Oder man erfreut sich an den wenigen guten, in "Utopia" vorkommenden Passagen, die es aus Kompatibilitätsgründen nicht hinüber zu "Gegenwelt" geschafft haben...
So, jetzt aber genug der erklärenden Worte.
Wer Gegenwelt kennt, und Zeit und Muse hat, sich die Trash-Version davon reinzuziehen, der lese weiter und bilde sich sein eigenes Urteil...
Ihr könnt es euch natürlich auch als Word-Dokument runterladen:
http://www.dianthesaint.de/Unity4.doc
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
++++++++++
„München. Bei einem Sprengstoffanschlag auf die Parteizentrale der Nationalen rechtsstaatlichen Union (NRU) ist am Dienstag Abend Sachschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro entstanden. Menschen wurden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen, da das Gebäude zur Tatzeit aufgrund eines wenige Stunden zuvor eingegangenen anonymen Anrufes rechtzeitig evakuiert worden war.
Zu dem Anschlag bekannte sich erneut die antifaschistischen Brigade... jene Nachfolgeorganisation der Roten-Armee-Fraktion, die bereits für mehrere Straftaten in diesem Jahr verantwortlich gemacht wird. Unter anderem für den Mord am umstrittenen Hamburger Richter Roland Schell und den Überfall auf das Jahrestreffen des ostpreußischen Vertriebenenverbundes, bei dem im Februar drei mutmaßliche Neonaziführer erschossen worden waren.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben die Ermittler des Sonderkommandos „Antifa“ nach eigenen Angaben noch keine heiße Spur, welche Personen sich hinter der antifaschistischen Brigade verbergen könnten. Unterdessen geht in konservativen und rechten Kreisen mehr und mehr Angst um... denn jeder könnte das nächste Opfer dieser selbsternannten „Mahner für den Frieden“ werden.“
++++++++++
Prolog
Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir noch Helden waren. Aufrechte Krieger ohne jegliche Arglist und Falschheit.
Mutig, entschlossen und entdeckungsfreudig zogen wir durch die Nachbarschaft und erkundeten unsere großartige kleine Welt... stets auf der Suche nach guten Freunden, neuen Abenteuern und Schwachen, denen wir zur Hilfe eilen konnten.
Alleine war es oft hart. Aber wann immer wir beisammen waren, vergaßen wir, dass die Erwachsenen in uns nur spielende Kinder sahen... dass sie uns nicht ernstnahmen und über unsere Leidenschaft für die alten Ritter, Robin Hood und die drei Musketiere nur amüsiert den Kopf schütteln konnten.
Doch für mich war es kein Spiel! Ein Spiel war nur von Bedeutung, so lange man es spielte. Ich aber dachte immer an diese Geschichten. Nicht nur, wenn ich mit den anderen in unserem Baumhaus saß. Nein, auch in der Schule, auf dem Bolzplatz oder beim gemeinsamen Abendessen mit meinen Eltern.
Ritterlichkeit war meine Religion, und ich nahm wie selbstverständlich an, dass meine Freunde auch so dachten... dass es für sie auch weit mehr war als nur Maskerade. Doch das war ein Irrtum.
Robin von Loxley, die schöne Lady Marian, Little John, Bruder Tuck. Sie alle sind längst nichts anderes mehr als ein verblasstes Foto aus fröhlichen Kindertagen.
Es begann damit, dass mein Freund Robin lieber mit den Kumpels seines älteren Bruders vor der örtlichen Tankstelle saß, als mit uns durch die Gegend zu ziehen. Little John tat es ihm gleich... meckerte ständig herum, dass wir ein uncooler Haufen seien, und beschäftigte sich fortan lieber mit HipHop und Breakdance als mit Ritterspielen.
Als dann auch noch Bruder Tuck ausfiel, da er im Gegensatz zu mir und den anderen aufs Gymnasium wechseln konnte, war unsere Tafelrunde am Ende.
Heute jobbt Bruder Tuck in der Rechnungsabteilung eines Unternehmens, das sich auf den Versand von Damenunterwäsche spezialisiert hat. Little John ist auf die schiefe Bahn geraten, dealte mit harten Drogen und wurde erst neulich auf ein paar Jahre Jugendstrafe verknackt.
Von Marian weiß ich nur, dass sie weit weniger hold und jungfräulich lebte als ihr Vorbild von damals. Es heißt, sie wurde mit fünfzehn zum ersten Mal schwanger, heiratete bald darauf einen brutalen Schlägertypen und ist seither Stammgast im städtischen Frauenhaus. Trotzdem kommt sie immer und immer wieder zu ihm zurück, wie Fliegen zu einem Haufen Scheiße.
Keine Ahnung, was aus Robin wurde. Das letzte Mal hatte ich ihn am Ende der neunten Klasse gesehen.
Jetzt ist jedenfalls nur noch einer übrig. Nur noch einer, dem die Werte von damals noch etwas bedeuten... und das bin ausgerechnet ich, der Sheriff von Nottingham.
Ich hatte mich früher eigentlich nie darum gerissen, der Böse zu sein. Aber einer musste es nunmal tun, und die anderen meinten, dass dazu niemand so gut geeignet wäre wie ich. Warum auch immer... das war jedenfalls irgendwie symptomatisch für mein ganzes Leben. Selbst in einer Gruppe von Außenseitern war ich noch das fünfte Rad am Wagen.
Alle sagten mir, die anderen wären mit der Zeit eben reifer und erwachsener geworden. Doch was hatte das alles mit Reife zu tun?
Sie haben sich meines Erachtens nicht im Geringsten weiterentwickelt. Alles, was sie getan hatten, war eine Art zu Leben und zu Denken gegen eine andere einzutauschen. Früher spielten sie edle Ritter, heute spielen sie junge Erwachsene, die zum Ritterspielen zu reif geworden waren.
Mir fällt auf, dass ich in den letzten Jahren zunehmend härter und zynischer geworden bin. Aber das ist ja auch kein Wunder. Seit unsere Gruppe auseinander gebrochen ist, läuft bei mir nämlich so ziemlich alles schief. Freunde besitze ich keine mehr, die Hauptschule habe ich ohne einen vernünftigen Abschluss abgebrochen, zu Hause bekam ich von meinem enttäuschten Vater die Leviten gelesen.
Was folgte, waren zwei Jahre Gelegenheitsjobs, die mir das Arbeitsamt beschaffte... und schließlich eine Lehre als Kfz-Mechaniker, die mich ungefähr genauso stark interessiert wie die Temperatur, die im Arschloch meine Großmutter herrscht... nämlich überhaupt nicht.
Endlose Tage lang schwänzte ich meine Ausbildung, wanderte nur mit einem kleinen Rucksack bewaffnet durch die Gegend... immer auf der Suche nach dem einen Gedanken, der mir das Glück zurückbringen sollte.
Ich fürchte, ich bin verdammt. Verdammt dazu, für immer der Sheriff von Nottingham zu bleiben... besser gesagt, dessen schlecht gelaunter, aber sich stets für das Gute einsetzende Zwillingsbruder, dessen Schicksal es ist, einfach nur da zu sein, ohne jemals in irgendeiner Heldensage Erwähnung zu finden.
Kapitel 1 - Von Rittern und Ameisen
Es ist Dienstag Morgen, irgendwann zwischen zehn und elf. Die Sonne steht noch nicht besonders hoch am Himmel, so dass die Temperaturen bis jetzt noch halbwegs erträglich sind.
„Eigentlich schade, dass kaum ein Mensch dazu kommt, die kostbaren Vormittagsstunden bewusst zu genießen.“, denke ich bei mir. Die einen müssen arbeiten, andere gehen zur Schule. Und die wenigen Glücklichen, die gerade Ferien oder Urlaub haben, wollen vermutlich endlich einmal ausschlafen oder wichtige Besorgungen erledigen.
Ich fühle mich beschissen... dabei sollte ich mich doch eigentlich privilegiert fühlen. Privilegiert, weil ich die Zeit habe, mich nur der frischen Morgenluft und den über den blauen Himmel ziehenden Schäfchenwolken zu widmen, während die Menschen um mich herum hektisch durch die Gegend hetzen müssen. Immer den nächsten Termin, den nächsten Einkauf, oder die nächste Pflicht vor Augen... ähnlich einer geschäftigen Waldameise, die wohl auch immer nur an das nächste Stück Holz oder den nächsten Eidechsenkadaver denkt, den sie in ihren Bau zu transportieren hat.
Ich frage mich, ob Ameisen auch manchmal innehalten, um die Schönheit des Waldes, in dem sie leben, zu bewundern. Haben sie Zeit, am blauen Himmel nach ihren Träumen zu suchen?
Lassen sich Ameisen krankschreiben, oder fälschen sie gar ein ärztliches Attest, um einmal ein paar Tage lang nicht zu der ihnen zugeteilten, verhassten Arbeitsstelle gehen zu müssen?
Hektik, Lärm, Hupen.
Ich muss raus aus der Stadt! Mit der S-Bahn fahren, bis zur Endstation... irgendwo ins Grüne. In ein Kaff, dessen Name wohl überhaupt niemand kennen würde, wenn er nicht auf den Fahrplänen des öffentlichen Nahverkehrs verzeichnet wäre.
Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass ich mich besser ein wenig beeilen sollte, wenn ich den Zug noch erwischen möchte. Also beschleunige ich meinen Gang, bis ich schließlich fast wie eine der Ameisen wirke.
Die Gesichter der Passanten, die mir unterwegs entgegenkommen, nehme ich gar nicht richtig wahr... mit der Zeit habe ich mir einfach angewöhnt, ihnen das gleiche Desinteresse entgegenzubringen wie sie mir.
Sicherlich wäre es schön, einen von ihnen, der mir gefällt, einfach mal ungezwungen ansprechen zu können... ein schönes Mädchen, oder einen sympathischen Jungen.
„Hey, du interessierst mich. Hast du mal kurz Zeit?“
Ich Träumer! So läuft das nunmal nicht. Keiner der Menschen, die mich interessieren würden, hätte Zeit für einen Fremden. Denn solche Menschen sind meist jung, gutaussehend und klug. Das heißt, sie haben vermutlich längst einen großen Freundeskreis, und sie würden für einen achtzehnjährigen Arbeitslosen, der sich für einen edlen Ritter aus dem Sherwood-Forest hält, wohl ohnehin nur Hohn und Spott übrig haben.
Bitte, meinetwegen... ignoriert mich, so wie ich euch ignoriere! Vielleicht bin ich bloß ein Geist, der ziellos durch eine für ihn mehr und mehr unverständlich werdende Welt irrt. Aber das ist im Zweifelsfall immer noch besser, als nur die Luft zu sein, an der dieser Geist achtlos vorüberläuft.
Hastig eile ich die Treppe der Unterführung hinunter. Beim um die Ecke biegen renne ich beinahe einen Polizisten um, der dort unten breitschultrig herumstolzierte, als würde ihm die halbe Welt gehören.
„Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, an mir eine Personenkontrolle durchzuführen.“, denke ich leise bei mir. Doch da hält mich der grimmig dreinschauende Beamte schon fest und murmelt seine gesamte Lebensphilosophie daher: „Polizei. Lassen sie mal ihren Ausweis sehen!“
Wunderbar. Scheiß Bulle!
Zu meiner latenten Verachtung gegenüber Ordnungshütern muss ich folgendes sagen: Eigentlich finde ich die Idee, dass es Menschen gibt, die sich um das Wohlergehen und die Sicherheit ihrer Mitmenschen kümmern, ja ziemlich gut. Der Freund und Helfer, der die Bürger des Staates vor Verbrechern beschützt... das hat ja fast schon etwas Ritterliches an sich. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es dagegen meistens so aus, dass ihre Kontrollen Rassismus und Schikane in Reinkultur sind.
So habe ich noch nicht einmal erlebt, dass ein Geschäftsmann mit Aktenkoffer, Anzug und Krawatte nach seinem Ausweis gefragt worden wäre. Aber wehe, jemand hat mal zu lange Haare, zu viele Löcher in seinen Jeans, ein zu wenig arisches Aussehen oder ist einfach nur zu schnell oder zu langsam unterwegs. Er kann seinen Arsch darauf verwetten, von der nächsten Polizeistreife angehalten und kontrolliert zu werden. Das ist keine Stichfahndung nach Kriminellen mehr, sondern vielmehr eine entwürdigende Strafmaßnahme dafür, dass man ein wenig zu sehr von der Norm abweicht.
Verhält sich ein Krabbeltier nicht wie eine ordentliche Ameise, kommen gleich die großen grünen Bundesameisen und kriechen dem Unglücklichen prüfend unter den Chitinpanzer. Wie sehr es den Stolz eines Ritters verletzt, wenn er seine Rüstung ablegen und sich befummeln lassen muss, kümmert sie nicht.
Endlich ist der Beamte fertig und lässt mich weiterziehen. Fast scheint er ein wenig enttäuscht darüber zu sein, dass ich trotz des hohen Tempos, das ich drauf hatte, kein gesuchter Al Kaida-Terrorist war.
Wütend renne ich davon. Wieder um eine Ecke, dann im Eilmarsch die Treppe nach oben.
Freunde und Helfer... dass ich nicht lache! Ich sage ja nichts dagegen, dass sie kontrollieren, wenn ein begründeter Verdacht besteht. Aber einfach so?
Jemand, der mir helfen wollte, würde sich jedenfalls anders verhalten.
„Entschuldigung... ich bin von der Polizei und wollte sie fragen, ob ich mal ihre Taschen ausleeren und ihren Personalausweis sehen darf. Sie kommen mir nämlich suspekt vor.“
„Nein. Für so was habe ich gerade keine Zeit!“
„Schade... es wäre gut für die Sicherheit des Staates und damit auch für ihr eigenes Wohlempfinden gewesen. Aber ich verstehe, dass sie beschäftigt sind. Tut mir leid, dass ich sie mit meinem Kontrollversuch belästigt habe.“
So würde ich mir das Ganze vorstellen! Helfen und schützen, aber ohne sich einem aufzudrängen. Die wirklich gefährlichen Verbrecher rennen ohnehin nicht hastig durch die gutbeleuchtete Bahnhofs-Unterführung einer Kleinstadt, sondern lassen sich im eigenen Privatjet um die Welt fliegen.
Der Bahnsteig ist beinahe menschenleer... von einem Zug weit und breit nichts zu sehen. Wie bei allem, was ich im Leben mache, scheine ich meiner Zeit ein wenig hinterherzuhinken. Jetzt schwindet die Aussicht auf einen erholsamen Tag in der Natur mit jedem Zentimeter, den der Minutenzeiger der allgegenwärtigen Bahnhofsuhr voranschreitet.
Wütend, frustriert... ja beinahe verstört wie ein nach Luft japsender Fisch, der in einer großen Wüste aus Beton und Stahl ausgesetzt und dann dort vergessen wurde, lasse ich mich auf eine der überall herumstehenden roten Kunststoffbänke sinken.
Ist das Leben nicht grausam?
Es sagt einem nicht: „Das und das musst du tun, um glücklich zu werden.“
Nein... es wirft einen einfach bloß in die Welt, lacht höhnisch und ruft: „Finde es gefälligst selber raus!“
Danke, Leben.
Danke für die vielen Fragen und die vielen damit verbundenen Kopfschmerzen.
Was bringt es mir zum Beispiel, dass ich mich für einen rechtschaffenen, guten Menschen halte, der sich in seinem Umfeld für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzt, so lange niemand auch nur einen feuchten Kehricht darauf gibt?
Vielleicht wäre es anders, wenn ich ein Ehrenhaftigkeits-Diplom hätte. Ein Zeugnis, das mir bescheinigt, dass ich ein gerechter Mensch bin. Ja, dann würden mir wahrscheinlich alle freundlich zulächeln und einen Job anbieten.
Ich frage mich, was das für eine Welt ist, in der Menschen nicht anhand von dem, was sie sind, ausgewählt werden, sondern durch das, was ihnen bescheinigt wurde zu sein. Vertraut niemand mehr auf sein Gefühl? Auf seine Menschenkenntnis?
Wenn ich ein Arbeitgeber wäre... ich würde mir die Menschen danach aussuchen, ob sie mir sympathisch sind und ob ich mich auf sie verlassen kann. Nicht danach, was sie angeblich für tolle Fähigkeiten haben. Ein Mitarbeiter, der mich als guten Freund betrachtet und mich, wenn eines Tages mein Haus niederbrennen sollte, bei sich wohnen lassen würde, wäre mir hundertmal lieber als einer, der zwar seinen Job beherrscht, aber mich nur als Mittel zum Zweck ansieht... genauso wie ich ihn.
Aber das verstehen die Menschen nicht. Sie wollen geblendet werden... von Aussehen, Talent, gute Noten. Leidtragende davon sind letztlich wir alle. Ich, genauso wie sie, wenn sie mal in eine Situation kommen, in der sie einen Freund wie mich prima hätten gebrauchen können.
Müde humpelt ein alter Mann an mir vorbei.
„Der hat’s gut. Der hat den ganzen Schwachsinn bald hinter sich.“, denke ich verbittert.
Auf einmal bleibt der Alte stehen und schaut mit einem trotzigen Funkeln in den Augen in meine Richtung... ganz so, als ob er meine Gedanken erraten habe und mir nun beweisen wolle, dass er noch lange nicht ans Abnippeln dachte.
Hastig wende ich meinen Blick von ihm ab. Es ist mir unangenehm, denn ich will niemandem zu nahe treten. Und ich will wohl auch nicht, dass mir jemand zu nahe tritt. Robin, Marian, Little John... die letzten Menschen, denen ich unbefangen in die Augen sehen konnte, haben mich allesamt verraten. Wenn mir jetzt jemand sagen wollte, dass die Augen die Fenster zur Seele seien, würde ich antworten, dass mich die Seelen meiner Mitmenschen einen Scheiß interessieren.
Ich lehne mich zurück, recke das Gesicht in die aufkommende Vormittagssonne, und versuche, wenigstens ein bisschen zu entspannen und vor mich hin zu dösen.
Doch es gelingt mir nur sehr bedingt... denn das immer lauter werdende Herumgegröhle einiger übermotivierter Vorstadtproleten dringt schon von Weitem an mein Ohr.
Ich versuche mir, einzig anhand der Gespräche, die sie führen, ihr Erscheinungsbild auszumalen. Eines dieser Spiele eben, das man zu spielen lernt, wenn man nur lange genug alleine durch die Welt streift.
Ich tippe auf Goldketten. Ja, sie haben sicher eine Menge Goldketten umhängen. Nicht wirklich teuer, und wohl auch nicht besonders stilvoll... aber garantiert protzig.
„Weischt du... der hat mir einfach ins Gesicht geglotzt, Alter. Da hab ich gesagt, er soll aufpassen, sonst ruf ich den Wasili an, und das des mein Kumpel isch. Den kenn ich vom Tanzkurs, weischt du. Und der hat gesagt, er hat ne echte Knarre und kennt sich voll aus mit allem.“
Ich verziehe amüsiert mein Gesicht und revidiere hastig meine vorige Prognose. Die Typen sind so peinlich, dass sie vermutlich kein Gold, sondern nur ein paar billige Silber-Imitat-Ketten tragen. Wahrscheinlich haben sie noch dazu mindestens genauso viel Pickel im Gesicht wie Gel auf den Haaren. Ein kurzer Blick über die Schulter bestätigt dann auch gleich meine schlimmsten Befürchtungen.
Auf einmal beginne ich mich zu fragen, wie verklärt die Legenden von Robin Hood und seinen Mannen wohl sein mögen. Vielleicht waren das ja in Wirklichkeit gar keine unerschrockenen Kämpfer für die Unterdrückten, sondern bloß eine Horde asozialer Bauernlümmel, denen es nur darum ging, cool zu wirken und möglichst schnell die Jungfrau Marian flachlegen zu können.
Wenn sie besoffen auf ihren Pferden durch den Wald ritten, fühlten sie sich stark und edel. Doch kaum verlor einer von ihnen die Gruppe aus den Augen, schiss er sich vor Angst in seine grünen Strumpfhosen. Wahrlich keine sehr erinnerungswürdige Vorstellung.
Ein gequältes Stöhnen holt mich in die Realität zurück. Überrascht blicke ich mich um, und sehe den alten Mann von vorhin hilflos auf dem Boden liegen... über ihn gebeugt mehrere der Jugendlichen, die sich einen ablachen und ihm drohend ihre Fäuste entgegenhalten.
„Rück den Cash raus, Opa. Oder du kannst gleich zu Oma in die Kiste hüpfen!“, schreit einer der Neuzeit-Robin Hoods.
„Na toll!“, fluche ich leise. Muss das jetzt sein? Und was macht die Polizei, wenn man sie einmal brauchen würde? Sicher einen harmlosen Schüler kontrollieren, der zu schnell durch die Unterführung gelaufen ist…
Ich überlege. Wenn ich dem Alten zur Hilfe eile, bekomme ich garantiert einen in die Fresse. Wenn ich ihm dagegen nicht helfe, muss ich mir eingestehen, dass ich keinen Deut besser bin als alle anderen. Und dann würde ich mir heute Abend mein blaues Auge vermutlich selber besorgen.
Die Entscheidung fällt mir also leicht.
„He, ihr Schurken! Gebt den König frei, oder ihr werdet mein Schwert zu spüren bekommen!“
Dumme Gesichter. Klickeldiklick. Ich höre deutlich, wie ihre Erbsengehirne arbeiten.
Welcher König? Welches Schwert? Sie verstehen es nicht. Aber sie sind offensichtlich klug genug, um zu kapieren, dass sie sich jetzt angepisst fühlen müssen, und stürzen wütend auf mich zu.
Unter einem heraneilenden Faustschlag tauche ich geschickt weg. Dann setze ich zu einem tiefen Fußtritt an. Knirsch. Unter den Baggypants bricht ein Schienbein.
Einer der Prolls schreit auf und stolpert zu Boden. Sein Kumpan trifft mich unterdessen mit der Faust am Ohr. Mit einem Mal verstummt die Welt um mich herum... nur noch ein lautes Pfeifen ist zu hören.
Verfluchter Strauchdieb! Den nächsten Schlag wehre ich erfolgreich ab. Scheinbar völlig geräuschlos. Dann findet mein Ellenbogen das Gesicht des Angreifers. Doch das genügt mir noch nicht. Ich ziehe ihm von oben nach unten eins über den Schädel. Ein Gefühl wie beim Holzhacken. Nur ohne Axt und ohne Holz. Und noch einmal. Dann treffe ich ins Leere... die Schurken flüchten.
Endlich höre ich auch wieder Schritte, und ihr panisches Geschrei. Der Pfeifton bleibt.
Noch etwas benommen schaue ich nach dem Alten, der immer noch vor mir auf dem Boden liegt. Sein Gesicht wirkt eigentlich gar nicht unfreundlich. Gütige Augen, ein gepflegter grauer Vollbart. Erinnert ein wenig an Richard Harris in Gladiator, nur mit deutlich kürzeren Haaren. Ich helfe ihm auf die Beine.
„Hast du was abbekommen, Väterchen?“
Er schmunzelt. Dazu muss ich sagen, dass diese altmodische Sprechweise eine Marotte von mir ist. Ich tue es nicht, um witzig zu wirken.
„Der König dankt dir, junger Recke!“, flüstert der Alte. Da sich seine Stimme doch ziemlich erschöpft anhört, greife ich ihm hilfsbereit unter die Arme.
„Wieder so eine Tat, für die mir niemand ein Diplom ausstellen wird.“, denke ich leise bei mir.
Die Dinge, die im Leben eines Menschen wirklich wichtig sind, interessieren nicht. Egal, wie oft man einem alten Mann aus der Patsche hilft. Egal, wie oft man sich edler verhält als alle anderen. Am Ende interessiert die meisten Menschen nur, wie gut man rechnen, putzen oder Akten bearbeiten kann.
Naja, immerhin kann ich darauf, dem alten Mann geholfen zu habe, stolzer sein als auf eine gute Note, die ich bei einer Klausur in irgendeinem stinkenden Uni-Hörsaal rausgeholt hätte. Im Schleichgang humpeln wir zur nahen Bank, wo wir uns erstmal müde fallen lassen.
„Eigenartig.“, meint der Alte nach einer ausgiebigen Verschnaufpause. „Die Art, wie du vorhin gekämpft hast... So etwas habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.“
Der alte Mann verwirrt mich.
„Was meint ihr?“
Sein Blick scheint mich durchdringen zu wollen. Dann rutscht er näher an mich heran... so, als wolle er mich etwas streng vertrauliches wissen lassen.
„Nun, ich will es einmal so ausdrücken: Eigentlich ging es doch nur um die bescheidene Rente eines dir unbekannten alten Mannes. Aber du hast gekämpft, als hinge dein ganzes Leben davon ab.“
„Vielleicht tat es das auch.“, entgegne ich leise. „Ich meine, meine Ehre ist zuweilen das Einzige an mir, das noch atmet und am Leben ist. Wenn ich sie verlieren und mich der Feigheit oder Schurkerei bezichtigen müsste, dann wäre ich nur noch totes Material... versteht ihr? Wie diese Züge, die hier entlangkommen. Vielleicht kraftvoll, vielleicht schnell, vielleicht zielstrebig... aber doch tot.“
Wie zur Bestätigung donnert im selben Moment ein grauer Eilzug vorbei. Ihm ist es egal, wenn abseits seiner Wegstrecke jemand zusammengeschlagen wird. Genau wie den meisten Menschen.
Überrascht nehme ich aus den Augenwinkeln wahr, wie der Alte an meiner Seite seine Brille aufsetzt, ein Handy aus der Tasche kramt und beginnt, gefühlvoll eine SMS einzutippen.
Bei jungen Leuten kann ich das auf den Tod nicht ausstehen, dafür bin ich wohl zu altmodisch. Doch bei dem Großvater finde ich es cool. Es ist so herrlich untypisch für einen Mann seines Alters.
„Oh, bitte entschuldige!“, meint er ein wenig beschämt, als er meinen neugierigen Blick bemerkt. „Ich musste nur kurz zu Hause Bescheid sagen, dass ich den Anschluss verpasst habe und es wohl nicht mehr rechtzeitig zum Tee schaffen werde.“
Ich muss heftig grinsen.
„Keine Bange... ich lache euch nicht aus!“, füge ich hastig hinzu, als mir der Alte fragend in die Augen schaut. „Mir ist nur gerade der Gedanke gekommen, dass wir beide ein prima Gespann abgeben würden. Ich meine, ich hinke meinen Altersgenossen hoffnungslos hinterher, während ihr den euren deutlich voraus zu sein scheint.“
Der alte Mann lächelt mir milde zu.
„Weißt du... ich denke manchmal, von Menschen, die nicht in ihre Zeit passen, kann es nie genug geben.“
„Das findet wohl nur ihr.“, erwidere ich verbittert. „Die meisten anderen belächeln mich dagegen für das, was ich bin. Um in heutiger Zeit ein Held zu sein, bedarf es keiner Ehrenhaftigkeit mehr. Heute ist man ein Held, wenn man bei Popstars gewinnt, schön aussieht und der Masse zu gefallen weiß.“
„Und du denkst, das war früher anders?“, fragt der Alte.
Ich zucke ein wenig ratlos mit den Schultern und schweige.
„Um die Wahrheit zu sagen...“, fährt er andächtig fort. „Der größte Held, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, wurde nie gefeiert oder bejubelt. Kein Verlag interessiert sich bis heute für seine Geschichte, kein Historiker misst seinen Taten irgendeine Bedeutung bei. Und weißt du warum? Weil er einfach nicht die Sorte von Held war, an die die Menschen im damaligen Nachkriegsdeutschland erinnert werden wollten.
Und doch... für mich und all jene, die ihn kannten, ist er zur Legende geworden. Zu einem Symbol des Widerstands.“
Der alte Mann nimmt seine Brille ab und schaut mir eindringlich in die Augen.
„Also, wenn du wirklich ein Held sein willst, Junge, dann erwarte besser nicht all zu viel Dankbarkeit oder Beachtung von deinen Mitmenschen. Werde ein Held für die Menschen, die du liebst... und lass es dir gleichgültig sein, wenn die übrigen Menschen etwas anderes aus dir machen.“
Verdammt... was soll ich ihm denn jetzt darauf erwidern? Dass ich eigentlich niemanden liebe, und dass mich wohl auch niemand als Symbol des Widerstandes ansehen dürfte? Was für ein Held wäre ich denn dann in seinen Augen?
Besser, ich lasse den alten Mann reden.
„Dieser Held, von dem ihr gesprochen habt... wollt ihr mir von ihm erzählen?“
Er lächelt.
„Wenn du die nötige Zeit mitbringst, um auch wirklich bis zum Ende zuzuhören... ja, gerne.“
„Ich wüsste nicht, was ich jetzt lieber machen würde als hier am Bahnhof auf einer roten Plastikbank zu sitzen und eurer Geschichte zu lauschen.“, erwidere ich.
„Du scheinst wirklich anders als deine Altersgenossen zu sein.“, bestätigt mir der alte Mann ungefragt. „Nun gut. Ich werde dir erzählen, was sich damals ereignet hat. Damals, als das Führen eines Krieges noch zu den liebsten Hobbys der Deutschen zählte, Millionen begeisterter Menschen vor dem Hakenkreuz salutierten... und man schon ziemlich ungewöhnliche Freunde haben musste, um sich nicht zu sehr von diesem ganzen Affentheater vereinnahmen zu lassen.
Es war das Jahr 1943, mitten im zweiten Weltkrieg. Eine Zeit, in der die Kindheit kurz und das Erwachsenwerden grausam war...“
Kapitel 2 - Die Prophezeiung
„Mein bester Freund Benjamin, genannt Benja, und ich hätten an jenem brütend heißen Sommertag eigentlich einer Sportveranstaltung der Hitlerjugend beiwohnen sollen. Ein germanisches Turnfest... mit völkischen Gesängen, schweißtreibenden Wettläufen und jeder Menge Fahnen und Parolen.
Nicht, dass ich das damals völlig abgelehnt hätte... schließlich kannten wir es nicht anders. Außerdem verband ich mit der HJ auch jede Menge schöner Erinnerungen. Doch an jenem Tag lockte uns bereits eine andere Feierlichkeit, deren Ruf weitaus eindringlicher und vielversprechender in unseren jugendlichen Herzen widerhallte. So schwangen wir uns also, nachdem wir uns wie gewohnt in voller Uniform von zuhause verabschiedet hatten, auf unsere Fahrräder und machten uns auf den Weg in die nahegelegene Stadt... denn dort war Jahrmarkt.
Kunterbunte Festzelte, Bier vom Fass und ein großes Karussell... da konnte das zuweilen doch recht strenge, disziplinierte Hitlerjungendasein einfach nicht mithalten.
Ich weiß noch genau, wie wir auf unseren Rädern durch den Wald rauschten. Benjas blonde Haare flatterten im Wind, und mir bereitete es sichtlich Mühe, mit seinem rasanten Fahrstil mitzuhalten.
„Wenn die das rauskriegen, werden wir eine Menge Ärger bekommen!“, rief ich ihm besorgt hinterher, während ich angestrengt versuchte, einigen spitzen Steinen auszuweichen, die scheinbar völlig nutzlos auf dem schmalen Waldweg herumlagen.
„Und wenn schon...“, kam prompt als Antwort zurück. „Dafür werden wir heute eine Menge Spaß haben.“
Er lachte... und da wusste ich, dass er Recht hatte.
Benja war wie ein Bruder für mich. Wir kannten uns von klein auf... wohnten in der gleichen Straße, und teilten die selbe Schulbank miteinander. Der Himmel weiß, was aus mir geworden wäre, wenn Benja dank seiner aufsässigen Art nicht immer so viel Abstand wie möglich zu Autoritäten, Partei und Jugendorganisationen gehalten hätte.
Eine Menge Leute erzählten damals, wie wunderbar die deutsche Zivilisation und die germanischen Bräuche wären... und wie stolz wir auf unsere Rasse und unseren Führer sein konnten. Aber nur Benja zeigte mir, was es bedeutete, frei wie ein wilder Mustang zu sein.
Als wir nach über halbstündiger Fahrt an dem kleinen Festplatz am Rande der Stadt ankamen, herrschte dort bereits geschäftiges Treiben.
Gutgelaunte Kinder mit Blumen in den Haaren tänzelten übermütig zwischen unseren Beinen hindurch... von überall her drangen ausgelassenes Stimmengewirr, das laute Werben der Budenbesitzer und schräge Drehorgelklänge an unser Ohr.
„Riechst du das auch?“, riss mich Benja aus meinen verträumten Gedanken.
„Was denn?“
Ich reckte die Nase in die Höhe, konnte aber außer dem typischen Rummelplatzgeruch nichts besonderes wahrnehmen.
„Na, Glück!“, erklärte er mir nachsichtig. „Wenn so viele Menschen gleichzeitig ausgelassen und fröhlich sind, kann man das förmlich riechen. Es liegt einfach eine ungeheure positive Stimmung in der Luft.“
Ich verstand.
„Du meinst, so wie neulich bei der Parade, als wir alle zusammen durch die Straßen marschierten und unsere neue Fahne weihten?“
Benja verzog das Gesicht.
„Also, wenn du mich fragst... da roch es nicht nach Glück. Da stank es vielmehr nach Hochmut!“
Er gab mir einen neckischen Klaps auf die Wange, bevor er seine Schritte beschleunigte und beinahe völlig im Gedränge verschwand.
„Wenn das Hochmut war, dann ist unser ganzes Land hochmütig.“, murmelte ich leise, ohne dass mich jemand hätte hören können. Dann rannte ich Benja hinterher.
Erst vor einem dunkelroten, etwas unheimlich wirkenden Zelt am anderen Ende des Festplatzes kamen wir erschöpft zum Stehen. Vor dem Eingang hingen mehrere tote Schlangen, die ganz zweifellos nicht gerade zu den kleinsten Vertretern ihrer Art gehörten. Darüber war ein seltsam dunkel leuchtendes Schild befestigt.
„Madame Elise kennt die Zukunft“, stand darauf mit verschnörkelter Schrift geschrieben.
Benja wollte vermutlich gerade einen abwertenden Kommentar über diesen Hokuspokus machen, verkniff es sich aber, als er überrascht bemerkte, wie ich in meiner Hosentasche nach unseren letzten Groschen kramte.
„Was denn?“, fragte er wenig motiviert. „Du willst da rein? Sag bloß, dir ist deine Zukunft wichtiger als ein bis zum Anschlag gefüllter Bierkrug?“
Ich wollte antworten... doch auf einmal nahm mich jemand von hinten brutal in den Schwitzkasten. Obwohl ich mich angestrengt zu wehren versuchte, hatte ich gegen den kräftigen Angreifer keine Chance. Erst als er mich endlich von sich weg auf Benja stieß, erkannte ich, um wen es sich handelte.
Es war Heinz Stauffer, Untergruppenführer unserer HJ-Verbandes, und ein typisches Beispiel dafür, dass Alter nicht zwangsläufig mit Weisheit einhergehen musste. Ich fand jedenfalls immer, dass es dem blonden Muskelpaket nichts geschadet hätte, hin und wieder statt dem Sportplatz auch mal eine Bibliothek aufzusuchen. Dass er diesmal nicht mit der kurzen HJ-Uniform, die seine Bizeps bedrohlich zur Geltung brachte, sondern in etwas biederer Zivilkleidung durch die Gegend lieft, machte ihn in meinen Augen auch nicht großartig sympathischer.
„Was machen sie denn da, Herr Gruppenführer?“, fragte Benja überrascht, aber wie gewohnt nicht gerade auf den Mund gefallen. „Müssten sie denn um diese Zeit nicht bei unserem Turnwettbewerb sein?“
„Bastian und Benjamin... sieh an.“, entgegnete Stauffer grimmig. „Das sollte ich wohl eher euch fragen.“
Er warf mir einen strengen Blick zu, worauf mir nichts Besseres einfiel, als betreten zu Boden zu starren.
„Aber falls es euch interessiert, ihr Schandstücke der HJ: Ich bin hier, weil ich meine Pflicht dem Reich gegenüber erfüllen will! Ich halte nämlich Ausschau nach Juden- und Zigeunerpack, das sich hier eventuell versteckt hält Bekanntlich gibt es davon im Schaustellergewerbe ja noch mehr als genug.“
Er verschnaufte kurz, dann starrte er mir wütend in die Augen.
„Und jetzt rückt auf der Stelle raus damit, was ihr hier verloren habt!“
Ich war schon fast so weit, den Widerling um Entschuldigung zu bitten und Besserung für unser Verhalten zu geloben... doch Benja kam mir zuvor.
„Verzeihen sie, Herr Gruppenführer.“, begann er gelassen zu erklären. „Aber ganz im Vertrauen: Wir sind auch dem Reich zu liebe hier!“
„Ach ja?“
Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich Stauffer so leicht bequatschen lassen würde... doch dann trat Benja auf einmal dicht an den wesentlich größeren und älteren Gruppenführer heran und legte vertraut seinen Arm auf dessen kräftige Schultern. Wie er sich dann sogar noch auf seine Zehenspitzen stellte, um mit Stauffer in etwa auf eine Höhe zu kommen... das fand ich schon ziemlich bewundernswert.
Dann legte er los.
„Haben sie schon mal Bier getrunken, das von gewissenlosen Zigeunern gebraut worden ist? Die verstoßen nämlich gegen jegliches Reinheitsgebot... zum Schaden von allen Volksdeutschen, die arglos von der Brühe kosten. Tja, und deshalb sind wir hier. Um das Bier eines jeden Ausschanks zu testen!“
„Das Bier, hä?“, antwortete Stauffer nachdenklich. Er schien eine Weile ernsthaft zu überlegen... dann klopfte er Benja kameradschaftlich auf den Rücken und grinste.
„Da habt ihr eine gute Idee gehabt, Jungs! Also dann macht mal weiter. Aber haltet etwas Abstand zu mir... ihr vergrault mir mit eurer Uniform sonst noch die ganzen Zigeuner!“
„Keine Sorge.“, flüsterte ich angewidert, nachdem er endlich verschwunden war. „Wir werden garantiert Abstand halten.“
„Darauf kann er einen lassen!“, versicherte Benja, und lachte mich mit seinen unschuldigen, blauen Augen an. Einmal mehr konnte ich nur bewundernd den Kopf über das enorme Selbstbewusstsein meines besten Freundes schütteln.
„Benja... du wirst dich mit deiner vorlauten Art noch mal gewaltig in Schwierigkeiten bringen!“, meinte ich, vielleicht ein wenig zu vorwurfsvoll.
Daraufhin schien er kurz ernst zu werden, grinste dann aber gleich wieder und entgegnete:
„Kann schon sein. Aber dann wirst du mich sicher wieder raushauen! Hab ich nicht Recht?“
„Natürlich!“, bestätigte ich entschlossen. „Oder denkst du, ich würde jemals zulassen, dass meinem besten Freund etwas geschieht?“
Das dachte er natürlich nicht... daher brauchten wir auch nicht länger auf dieses Thema einzugehen.
Sehnsuchtsvoll schaute ich zurück zum Eingang des Wahrsagerzeltes.
„Komm schon, lass uns doch wenigstens mal reingehen. Denn wenn man keine Fragen an die Zukunft stellt, wird man auch nie eine Antwort erhalten!“
Drinnen im Zelt war es ziemlich dunkel, und es roch nach einer äußerst gewöhnungsbedürftigen Mischung aus Lavendel und Pferdemist. Vor einem kleinen Tischlein saß eine alte, verschrumpelte Großmutter. Sie trug ein buntes Kopftuch und an jedem Ohr zwei große, golden schimmernde Kreolen.
Als sie uns bemerkte, stand sie zuerst überrascht auf, setzte sich dann aber wieder und starrte uns gleichgültig an.
„Wollt ihr, dass ich euch die Karten lege?“, fragte sie in einer monotonen Tonlage, die uns verriet, dass sie offensichtlich nicht besonders gut auf unsere Uniformen zu sprechen war.
„Ja, bitte.“, erwiderte ich, als hätte ich ihre Aversion gegen uns nicht bemerkt.
Daraufhin kramte die Alte einen Stapel Karten hervor und begann, sie mürrisch auf dem Tisch auszubreiten. Die Karten trugen seltsame, fremdländische Symbole... und es hatte den Anschein, als würde die alte Wahrsagerin, je länger sie darauf starrte, mehr und mehr Interesse daran entwickeln.
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie endlich fertig war und prüfend zu uns aufschaute. Dann lächelte sie auf einmal und nickte uns verständnisvoll zu.
„Ihr seid gute Menschen!“, meinte sie... offensichtlich fast ein wenig erleichtert.
„Das steht da drin?“
Benja musste natürlich gleich mal wieder seine Skepsis zum Ausdruck bringen.
„Nein.“, erwiderte die Alte, die jetzt um einiges warmherziger wirkte als zuvor. „Das habe ich in euren Augen gesehen.“
„Und was steht in den Karten?“, hakte Benja ungeduldig nach.
Die Alte schien zu zögern.
„Wird einer von uns bald ein schönes Mädchen kennenlernen?“, platzte schließlich die Frage aus mir heraus, die wohl auch der eigentliche Grund für mein Interesse an jenem düsteren Zelt gewesen war.
„Ja, ihr werdet ein hübsches Mädchen treffen!“, prophezeite die Wahrsagerin. „Sie wird euch sozusagen direkt in die Arme fallen... und ihr werdet euch in sie verlieben!“
Ich grinste verlegen zu Benja rüber.
„Wie denn... beide in die selbe?“
Benja schüttelte amüsiert den Kopf.
„Ich wette, das erzählen sie jedem, stimmts? Genauso, wie dass unser Leben lang und erfüllt sein wird.“
„Nein!“, herrschte ihn die Alte urplötzlich an... mit einem Blick, der so dermaßen eindringlich war, dass er mir ziemliche Angst einjagte.
„Sein Leben wird lang und erfüllt sein!“
Sie deutete auf mich... dann blickte sie fast ein wenig trotzig zurück zu Benja.
„Dein Leben hingegen wird auch erfüllt sein... aber viel zu kurz... viel zu kurz...“
Ihre Lippen bewegten sich, ohne noch ein weiteres Wort hervorzubringen. Das Ganze war so dermaßen gespenstisch, dass ich trotz der enormen Hitze im Zelt unwillkürlich zu frösteln begann.
Ob es Benja ähnlich ging, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen. Er schien sich jedenfalls nicht so leicht wie ich von der Alten beeindrucken zu lassen.
„Wenn die Karten so viel wissen... dann verraten sie mir doch mal, ob Adolf Hitler auch ein guter Mensch ist!“
Ich versetzte Benja einen empörten Hieb in die Seite, denn mir war damals völlig schleierhaft, was er mit solch einer provozierenden Frage bezwecken wollte. Auch die Wahrsagerin schien nicht besonders begeistert davon zu sein.
„In diesen Zeiten...“, murrte sie leise, „wissen selbst die Karten, wann sie besser zu schweigen haben. Es ist wohl ratsam, wenn ihr jetzt geht!“
Ihre letzten Worte klangen so bestimmt, dass ich Benja an der Schulter packte und ihn unsanft zum Verlassen des Zeltes aufforderte.
„Danke, gute Frau!“, meinte ich noch hastig, bevor ich ihr sämtliche Groschen, die sich noch in meiner Hosentasche befanden, auf den Tisch legte und Benja mit mir nach draußen zog.
„Die alte Krähe hat dich ziemlich beeindruckt, was?“, amüsierte sich Benja, als er mein offensichtlich ganz schön blass gewordenes Gesicht erblickte.
„Ja, und? Dich etwa nicht?“
Benja lachte.
„Wieso denn? Das ist doch schließlich ihr Job. Wenn man naiv und gutgläubig ist, erzählt sie einem das, was man hören will. Wenn man aber zweifelt, so wie ich, dann versucht sie, einen in Angst und Schrecken zu versetzen. Eigentlich das selbe Prinzip wie in der Kirche. Zumindest hat sie uns ne gute Show geliefert, und wir haben ihr dafür unsere Groschen gegeben. Ich denke, in etwa genau das hat sie damit auch erreichen wollen.“
„Wenn du meinst...“
Gut möglich, dass Benja Recht hatte, und die Alte nur auf unsere Ersparnisse aus war. Vielleicht wollte sie Benja auch wegen seiner vorlauten Zunge eine Lektion erteilen.
Nichtsdestotrotz hatte sie mich mit ihrer Vorstellung in den Bann gezogen. Ihr Geld war sie jedenfalls eindeutig wert gewesen.
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir größtenteils damit, auf dem Festgelände herumzutollen und beim Ausschank des örtlichen Fußballvereins, an dem einer von Benjas Cousins bediente, das eine oder andere Maß Bier zu schnorren.
Erst, als es schon langsam dunkel zu werden begann, entschieden wir uns dazu, uns wieder auf den Heimweg zu machen.
Wir waren schon ziemlich angeheitert... jedenfalls erkannten wir nach ein paar vergeblichen Fahrversuchen, dass wir unsere Räder besser schieben sollten. Unser Weg durch den Wald würde dadurch ziemlich lange dauern. Ich versuchte, besser gar nicht daran zu denken, wie müde ich schon war... und dass wir am nächsten Tag gleich morgens in der Früh zu einer Vollversammlung unserer Ortsgruppe mussten.
Benja fluchte laut.
„Dieser verdammte Scheißverein nervt mich total, weißt du das? Am Liebsten würde ich ja gar nicht mehr hingehen.“
Er machte keinen Hehl daraus, dass er seine Freizeit lieber alleine mit mir als mit den ganzen Leuten von der HJ verbringen wollte.
„Echt Mann, das ist nicht fair! Eigentlich könnte jeder Tag so genial sein wie der heutige. Aber nein... wir müssen zu den braunen Jungs. Und wenn ich’s nicht mache, bekomme ich wieder Prügel. Von meinem Vater... von Stauffer... eigentlich von allen.“
„Von mir nicht.“, erwiderte ich mit einem leichten Lächeln, um ihn wieder ein wenig zu beruhigen. „Trotzdem, Benja. Wir Deutschen sind nunmal so etwas wie eine große Familie. Und wie eine Familie hat eben ein jeder nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten...“
„Verflucht!“, schrie Benja unbeherrscht, als ob es dadurch besser werden würde.
„Das weiß ich ja selber. Aber in der Familie, in der ich leben möchte, läuft das so wie bei mir und meinem Cousin ab. Wenn ich ihm auf dem Feld helfe, bekomme ich hin und wieder eine Flasche Most von ihm. Wenn ich ihm dagegen nicht helfe, bekomme ich eben keine Flasche Most. Aber er prügelt mich deshalb nicht oder sperrt mich irgendwo ein. Verstehst du den Unterschied?“
Ich nickte.
„Schon klar. Du meinst, dass das alles auf einer freiwilligen Basis passieren sollte. Und da hast du ja auch meine volle Zustimmung. Aber sei mal ehrlich, in welcher Familie geht es schon völlig ohne Zwang zu? Dein Vater haut dich doch schließlich auch manchmal, wenn du Mist gebaut hast...“
„Der ist ja auch nicht viel besser als Hitler!“, fauchte Benja zurück. „Aber Basti, hör mir gut zu: Eines Tages werde ich mich nicht mehr schlagen lassen... von niemandem! Dann werde ich nämlich groß und stark sein, mich aufrecht vor sie hinstellen und einem jeden ins Gesicht spucken, der mich zu irgendwas zwingen will.“
„Du würdest sogar auf Hitler spucken?“, fragte ich fasziniert, obwohl ich mir die Antwort ja denken konnte.
„Ich, mein lieber Basti,“, antwortete Benja pathetisch, „Ich werde eines Tages stark genug sein, um sogar einem neunköpfigen Drachen ins Gesicht spucken zu können!“
„Und wen er dich dann frisst?“
Benja sah mich mit gespieltem Ernst an.
„Dann soll er daran ersticken!“
Daraufhin mussten wir beide laut loslachen. Ich, weil es mich immer wieder amüsierte, was für einen Blödsinn man reden konnte, wenn man betrunken war, und Benja... ich weiß es nicht. Ich glaube, er lachte aus einem anderen Grund.
Irgendwie schien es auf dem kleinen Waldweg mit einem Mal tropisch heiß geworden zu sein. Das bemerkte ich vor allem daran, dass mir längst der Schweiß auf der Stirn perlte und meine Beine immer schwerer wurden.
Erschöpft zog ich mein Hemd aus und hing es über die Stange meines Fahrrades.
„Ich glaube, ich brauch ne Pause.“, flüsterte ich in Richtung von Benja, der mir verständnisvoll zulächelte.
„War wohl etwas viel heute, was? Am Besten, wir setzen uns ein Weilchen hin.“
Er ging auf mich zu, um mir ein wenig unter die Arme zu greifen. Auch wenn es mir eher so schien, als würde er im Kreis um mich herumtanzen. Ich wollte mich auch bewegen, doch dann hielt mich Benja urplötzlich zurück.
„Warte!“, mahnte er aufmerksam. „Hörst du das auch? Da kommt was auf uns zu!“
Jetzt fiel es auch mir auf. Noch bevor ich Benja fragen konnte, was dieses schnell lauter werdende Geräusch zu bedeuten hatte, preschte ein von Pferden gezogener Wagen hinter uns aus der Kurve hervor.
Benja stieß mich hastig von der Straße. Dann sah ich das Gefährt auch schon in einem Höllentempo an uns vorüberrasen. Durch den Fahrtwind verspürte ich eine angenehme Kühle... und fast im selben Moment vernahm ich einen lauten Schrei.
Das nächste, was ich sah, war splitterndes Holz und diese Gestalt, die durch die Seitentüre des Wagens auf mich zuflog. Dann stieß mein Kopf gegen irgendetwas Hartes, und ich verlor das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir kam, war Benja besorgt über mich gebeugt.
„Was ist passiert?“, fragte ich und rieb mir benommen den brummenden Schädel. „Ich fühle mich, als hätte mich ein riesiges Wildschwein überrannt!“
„In gewisser Weise trifft das auch zu.“, erwiderte Benja trocken, und forderte mich mit einem demonstrativen Blick zu meiner Rechten auf, mich einmal umzudrehen.
Angestrengt hob ich den Kopf und drehte mich langsam zur Seite. Dort, eingebettet in Heu und getrocknetes Blut, lag unser Gruppenleiter, Heinz Stauffer. Seine starr in den Himmel gerichteten, weitaufgerissenen Augen und die steife Körperhaltung konnten nur eines bedeuten.
Erschrocken sprang ich auf.
„Scheiße! Ist er... tot?“, fragte ich Benja, den das Ganze offensichtlich weit weniger geschockt zu haben schien als mich.
Seelenruhig berührte er Stauffers Körper mit einem langen Ast... drückte sogar prüfend das Gesicht unseres Gruppenleiters von der einen Seite auf die andere. Dann warf er mir einen düsteren Blick zu, der mir bisher so noch gar nie bei ihm aufgefallen war.
„Der ist genau so tot, wie ich es mir immer gewünscht habe.“, meinte er leise.
Natürlich konnte ich das nicht einfach unkommentiert stehen lassen.
„Verdammt, Benja. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Arschloch sein kannst!“, empörte ich mich. „Das ist unser Gruppenleiter, der da liegt... und nicht irgendeine überfahrene Katze!“
Benja antwortete nicht. Stattdessen ging er in die Knie, um Stauffers Leichnam genauer untersuchen zu können.
„Sieh dir das an!“, meinte er schließlich, und deutete auf die rechte Hand des Toten. Darin befand sich etwas, das für mich wie ein Ausweis aussah... fast schien es so, als habe sich Stauffer rettend daran festhalten wollen, als er aus dem Wagen gestoßen wurde.
„Lass uns von hier verschwinden!“, murmelte ich verunsichert.
Einen toten Mann im Wald zu finden, brachte einem nichts als Ärger ein. Vor allem, wenn man diesen Mann auch noch persönlich kannte... das wusste ich aus zahllosen Kriminalromanen. Und so wollte ich eigentlich am liebsten so schnell wie möglich weg von hier.
Doch Benja hörte nicht. Stattdessen nahm er Stauffer den Ausweis aus der starren Hand und begann, interessiert darin herumzublättern.
„In Ordnung, mach was du willst!“, giftete ich ihn an. „Aber ohne mich! Ich geh jetzt nach Hause.“
Benja schielte ein wenig ratlos zu mir rüber.
„Was soll das, Basti? Wir sind Freunde! Oder hast du das vergessen?“
„Nein.“, antwortete ich gereizt. „Aber vielleicht hast du es ja vergessen...“
„Hab ich nicht.“
Er lächelte. „Tut mir leid. Du hast Recht. Lass uns nach Hause gehen und nicht mehr von der Sache reden.“
Erleichtert klatschte ich seine Hand ab. Dann machten wir uns aus dem Staub.
Ich war mir noch eine Weile unsicher, ob wir richtig gehandelt hatten, oder ob wir nicht doch einfach nur zu feige gewesen waren, um uns als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Aber da Benja davon ganz offensichtlich ohnehin nichts mehr wissen wollte, war die Sache für mich erledigt. Zumindest glaubte ich das... tatsächlich hatten unsere Schwierigkeiten damit aber erst so richtig begonnen.“
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 3 - In Gefangenschaft.
Der Alte schaut ungeduldig auf seine Uhr. Für eine Weile scheint es beinahe so, als würde er auf eine göttliche Eingebung warten. Dann klopft er schließlich kumpelhaft mit seiner runzligen Hand auf meinen Oberschenkel.
„Ok, es ist Zeit. Ich werde dir die Geschichte dann weitererzählen, wenn du wieder aufgewacht bist.“
Ich schaue ihn verwundert an.
„Aufgewacht? Ihr müsst euch irren! Ich bin eigentlich keineswegs...“
Weiter komme ich nicht, denn ein schmerzhafter Stich im Nackenbereich lässt mich erschrocken zusammenzucken.
Noch während ich meinen Kopf nach hinten beuge, um den Grund für diesen Schmerz zu erfahren, scheint der ganze Himmel über mir in Bewegung zu geraten. Unkontrolliert tanzen die Wolken vor meinem Auge hin und her. Ich sehe zwei Gestalten, fies lachend, mit einer langen Nadel in der Hand. Dann wieder den Alten, der mir irgendetwas zuzurufen scheint. Ihre Fratzen vermischen sich mit den Wolken zu einer unsichtbaren Nebelwand, bis sie schließlich wie eine gewaltige Flutwelle über mich hereinbrechen. Ich verspüre einen ungeheuren Druck in meinen Adern.... dann wird alles Bewusstsein davongespült.
Ich versinke in Finsternis.
Geisterhafte Schemen huschen an mir vorbei... kurze Momentaufnahmen aus der Kindheit.
Ich sehe meinen Vater. Gütig, aber stets in Angst vor der Zukunft lebend. Ich sehe ihn, wie er mit Sorgenfalten auf der Stirn mein letztes Zeugnis betrachtet. Da ist kein Vorwurf in seinen Augen... eher Trauer. Als ob jemand gestorben wäre.
Tatsächlich war es seine Hoffnung, die an jenem Tage starb. Seine Hoffnung darauf, dass er sich mal irgendwann nicht mehr um mich würde sorgen müssen... und ich habe sie umgebracht!
Natürlich fühle ich mich ganz schön mies deswegen, auch wenn ich ja eigentlich weder für die Gefühle meines Vaters, noch für die Welt, in der wir beide zu leben haben, etwas kann.
Vielleicht haben ja auch meine Lehrer Schuld... oder die Arbeitgeber, die mich nicht einstellen wollten, weil meine Noten zu schlecht waren und weil ich bei den Bewerbungsgesprächen zu wenig Motivation geheuchelt habe...
Es ist müßig, darüber nachzudenken. Ganz sicher weiß ich nur eines:
Denen sind die Sorgenfalten auf der Stirn meines Vaters immer egal gewesen... mir nicht! Das ist der Unterschied. Und in Zweifelsfall bin ich immer noch lieber ein mitfühlender Versager als das Gegenteil davon.
Das Gegenteil von was?
Ich fliege weiter durch meine Vergangenheit... vorbei an Robin und Marian. Kaum zu glauben, dass ich mal so was wie verliebt in sie war.
Wie oft lieben wir keine Menschen, sondern nur die Vorstellung, die wir von ihnen haben? Man liebt einen Traum. Und wenn er vorbei ist, hasst man ihn dafür, dass man ihn geträumt hat.
Träume ich?
Hasse ich?
Liebe ich noch?
Ich sehe Toadwart, meinen Hund... erinnere mich daran, wie ich in einsamen Stunden mit ihm über die Felder getobt bin. Er war wohl die edelste Seele im ganzen Dorf. Treu, zuverlässig, und mutig. Doch wie alle guten Ritter ging auch er daran zu Grunde, dass es nichts mehr gab, wofür er zu kämpfen hatte. Er suchte seine Ersatzbefriedigung in der Jagd nach aufgeschreckten Feldhasen, was ihn schließlich blindlings vor den Kühler eines herannahenden Vierzigtonners laufen ließ.
Die Realität hatte ihn eingeholt.
Wann wird wohl der Truck kommen, der für mich bestimmt ist?
Aggressive Stimmen brennen sich durch meine Erinnerungen.
„Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gerade jetzt, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen...“
„Und, was schlägst du vor? Bastian wird schon wissen, was er tut. Er hat es bisher immer gewusst. Wir sollten ein wenig mehr Vertrauen in ihn haben, findest du nicht?“
„Vertrauen, vertrauen... es ist einfach nicht die richtige Zeit, um zu vertrauen, Jamiro. Die Scheiße ist gewaltig am Brodeln.“
„Psst, ich glaube, er ist wach!“
Bin ich?
Ich öffne müde die schmerzenden Augen.
An der Decke brennt eine grelle Halogenlampe, die Luft ist stickig.
Das ist nicht der Bahnhof.
„Willkommen im Paradies!“, scherzt jemand selbstsicher und beugt sich neugierig über mich. Ich erkenne zwei auffällig grün funkelnde Augen, die mich regelrecht anzulachen scheinen. Ein jugendliches Gesicht... dazu mittellange braune Haare, in die kunstvoll einige weiße Dreadlocks eingewebt wurden. Sein rechter Arm ist in einen weißen Gips gehüllt.
Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass von dem Typen eine Gefahr ausgeht.
Ich schiele zur Seite, doch ich kann nichts Außergewöhnliches erkennen. Nur eine Holzwand und ein paar auf dem Boden herumstehende Blechkisten. Auch, als ich in die andere Richtung schaue, sehe ich nichts, was irgendwelche Rückschlüsse auf meinen Aufenthaltsort zulassen würde. Höchstens die, dass der Raum, in dem ich mich befinde, definitiv zu groß ist, um in einer normalen Wohnung in irgendeinem Mietshaus liegen zu können. Vielleicht eher in einer Lagerhalle oder ähnlichem.
„Das Paradies?“, flüstere ich noch ein wenig benebelt.
„So sagt mir denn, wo sind Wein, Weib und Gesang? Und wo ist die Schlange, die ich im Paradiese vorzufinden erwarte?“
„Ist gerade ne blöde Zeit für Partys“, antwortet der junge Rasta-Typ nachdenklich.
„Und Schlangen haben wir hier keine. Das ist ja gerade der Gag an der Sache.“
„Aber draußen...“, fällt ihm ein anderer, der sich wohl hinter meinem Rücken befinden muss, ins Wort. „Draußen gibt es jede Menge Schlangen, nicht wahr?“
Ich sehe mich um... schaue in das Gesicht eines südländisch aussehenden Jungen mit langen schwarzen Haaren. Irgendwas ist merkwürdig an ihm. Ich kann aber nicht genau sagen, was.
„Dann habe ich es also euch zu verdanken, dass ich meine Sinne verloren habe, richtig?“
Der Rasta lächelt mal wieder.
„In gewisser Weise schon.“, antwortet er, und wirft seinem etwas älter wirkenden Kumpanen dabei einen verschwörerischen Blick zu.
„Man könnte allerdings auch sagen, dass du dir das alles selbst eingebrockt hast. Weißt du... wer sich so wie du verhält, fällt uns eben auf.“
„Ihr habt jedenfalls eine etwas seltsame Art, euch für meine Hilfe zu bedanken.“, murmele ich ein wenig verstimmt. „Der alte Mann... der steckt doch mit euch unter einer Decke, hab ich Recht?“
„Wir sind die Decke.“, höre ich eine vertraute Stimme aus dem Hintergrund. „Utopia... oder was davon nach all den Jahren noch übrig ist.“
Da ist ja der Alte wieder! Langsam kommt er näher und legt den beiden Jüngeren milde lächelnd die Hand auf die Schulter.
„Verzeihe uns unsere schlechten Manieren. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das hier ist Jamiro!“. Er deutet auf den Südländer. „Nicht annähernd so sanftmütig, wie es seine Augen vermuten lassen... aber hundertprozentig loyal, wenn es mal drauf ankommt.“
Dann zeigt er auf den Rasta. „Und dieser Knabe hier ist der beste Skater in unserem Team... und definitiv auch einer der Hübschesten: Saphire Rage.“
„Saphire genügt.“, ergänzt der Junge mit den Dreadlocks hastig.
„Saphire Rage... alles klar.“, flüstere ich mit einem etwas sarkastischen Unterton. „Und ich dachte immer, ICH wäre verrückt.“
„Du solltest ein Buch nicht anhand des Umschlags beurteilen. Vor allem, wenn du nicht weißt, unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Lies es erst mal!“, rät mir Saphire ernst, aber anscheinend ohne irgendwelchen Groll gegen mich zu hegen.
„Ach ja, und der Opa hier, das ist übrigens Bastian.“
„Bastian... fein.“, entgegne ich. „Könnt ihr mir jetzt vielleicht endlich verraten, was zur Hölle hier gespielt wird?“
Der Alte schenkt ein Glas Wasser ein und reicht es mir vorsichtig rüber. Er muss wohl gewusst haben, dass ich einen völlig ausgetrockneten Mund haben würde.
Gierig kippe ich das kühle Nass herunter.
„Du hast doch zugestimmt, dass du dir meine Geschichte anhören wolltest. Also worüber beklagst du dich jetzt eigentlich?“
„Nun... ich wusste nicht, dass sie mich so dermaßen gefangennehmen würde.“, entgegne ich dem Alten vorwurfsvoll.
Der nickt mir nachsichtig zu.
„Hab ein wenig Geduld mit uns... Du wirst schon bald verstehen, warum du hier bist. Aber jetzt lass uns doch erst einmal etwas Essen gehen.“
Ich folge den dreien durch ein Gewirr an Gängen. Kein Fenster in Sicht, aus dem ich schließen könnte, wo ich mich hier befinde. In einem Hochhaus im 23. Stock? Oder tief unter der Erde in einem geheimen Militär-Bunker?
Links und rechts von mir tun sich zahllose Regale, Kisten und vollgekritzelte Aktenschränke auf. Wir kommen durch einen großen Raum, an dessen Wänden zahllose Listen und Plakate hängen. Auf einem Pult ist eine große Landkarte ausgebreitet... das Ganze wirkt wie das Besprechungszimmer der Einsatzleitung in irgendeinem drittklassigen Katastrophenfilm.
Der nächste Raum sieht freundlicher aus. In der Mitte steht eine große, reichgedeckte Tafel. Mehrere Leute sind bereits drum herum versammelt... ein paar alte, ein paar junge. Auch Frauen und Mädchen sind darunter.
Einige schielen gespannt in meine Richtung, als ich mit meinen drei Begleitern an ihnen vorbeigehe. Wieder andere scheinen mich kaum wahrzunehmen... sie sind wohl zu sehr mit Essen oder anderen Dingen beschäftigt.
Die Hälfte der Stühle ist jedoch noch leer.
„Normalerweise ist hier mehr los.“, erklärt mir Saphire bereitwillig, als er meinen fragenden Blick bemerkt.
„Viele von uns sind gerade bei einer Demo gegen die NRU.“
„Die was?“
Jetzt schaue ich noch fragender.
„Nationale rechtsstaatliche Union. Oder anders formuliert, die „Wir-Deutschen-sind-was-Besseres-und-wollen-uns-nicht-mehr-an-unsere-Vergangenheit-erinnern“-Partei.“
„Braune Scheiße.“, fügt Jamiro erklärend hinzu.
Ich kann mir ungefähr vorstellen, was er meint.
„Verzeiht, aber Politik ist nicht mein Metier. Ich wähle keinen dieser Halsabschneider, und erwarte dafür von denen in Ruhe gelassen zu werden.“
„Das hat mir schon mal jemand gesagt.“, meint der alte Bastian amüsiert. „Er starb 1944 in Auschwitz.“
Wir setzen uns auf ein paar freie Plätze am anderen Ende der Tafel. Das Essen sieht lecker aus, auch wenn ich nicht genau erkennen kann, um was es sich dabei handelt.
„Das ist eine deutsche Spezialität.“, ruft einer von der gegenüberliegenden Seite in meine Richtung.
„Was, dieses komische Fleisch da?“, antworte ich verwirrt. Einige fangen an, ziemlich kindisch zu feixen und sich gegenseitig abzuklatschen.
„Nein, Mann... die Annahme, dass es ausreicht, den Kopf in den Sand zu stecken, damit er nicht abgeschlagen werden kann!“
„Ach so.“, erwidere ich kleinlaut. Vielleicht hätte ich mich doch etwas mehr für Politik interessieren sollen.
„Nun, verlasst euch drauf, dass ich meinen Kopf nicht in den Sand stecke! Auch wenn es mir an eurem Politikwissen zu mangeln scheint.“
Saphire fasst mir von der Seite an die Schulter.
„Hey, du hast Bastian gerettet. Ich denke, für heute brauchst du dir keine Vorwürfe mehr zu machen!“
Ich nicke ihm zu. Wenigstens einer, der das auch noch so sieht wie ich.
„Und... verratet ihr mir jetzt, wo ich mich hier befinde?“, frage ich schmatzend, nachdem ich mir ein belegtes Brötchen und irgendeine undefinierbare Frucht einverleibt habe.
„Trotz der vielen jungen Leute hier scheint es sich ja nicht um ein Waisenhaus oder den örtlichen Jugendclub zu handeln.“
„Ein Waisenhaus? Nun, in gewisser Weise ist es das durchaus.“, erklärt mir Bastian bereitwillig. „Einige der Jungen und Mädchen hier haben kein richtiges zu Hause mehr.“
„Quatsch!“, fällt ihm Jamiro wild gestikulierend ins Wort. „Die Wahrheit ist doch: Dies hier ist unser Zuhause. Du bist hier in Utopia! Wir sind eine Familie. Keiner stellt sich über einen anderen, niemand gibt Befehle... alle sind gleich. Scheiß auf die Welt da draußen!“
„Ja, ist gut, Jam. Krieg dich wieder ein!“, ruft ihm Saphire beruhigend zu... woraufhin eine Tomate an Bastian vorbeifliegt und direkt neben Saphires Arm auf der Tafel landet.
Der Alte wirkt genervt.
„Warum spielt ihr nicht draußen, wenn ihr kein Interesse an einer zivilisierten Unterhaltung habt?“
Das lässt sich Saphire nicht zweimal sagen und greift eilig nach der schon etwas zermatscht aussehenden Tomate.
„Ja, Jamiro. Lass uns spielen gehen!“
Die beiden springen auf, rennen ungestüm aufeinander zu und verschwinden dann hinter einer breiten Türe.
Bastian nutzt die Gelegenheit, um etwas näher an mich heranzurücken.
„Kaum zu glauben, wie prächtig sich junge Menschen entwickeln können, wenn man ihnen nur die Chance dazu gibt.“, sinniert er.
„Und ihr... ihr gebt den Leuten hier eine Chance?“, erwidere ich, überzeugt davon, der Wahrheit allmählich etwas näher zu kommen.
„Ich?“
Bastian lächelt vielsagend.
„Ich halte Utopia am Leben, so gut ich kann. Genau so, wie es vor mir andere getan haben, und wie es nach mir Jam, Saph oder sonst irgendjemand tun wird.“
„Was ist dieses Utopia?“, frage ich neugierig.
„Ich habe diese Bezeichnung jetzt schon einige Male aus eurem Munde vernommen. Erzählt ihr mir endlich, was es damit auf sich hat?“
Zuerst scheint er antworten zu wollen, doch dann steht der Alte ruckartig auf und ruft einem Mädchen am anderen Ende des Raumes, das anscheinend irgendein Problem hat, zu, dass es besser in den Hof gehen und Saphire fragen solle.
„Der kann dir das garantiert besser erklären als ich, Mia!“
Er schaut ihr amüsiert hinterher, bis sie ebenfalls hinter der Tür verschwunden ist. Dann erst widmet er sich wieder unserem Gespräch.
„Um ehrlich zu sein: Ich kann dir nicht genau sagen, was Utopia eigentlich ist... nicht mal nach all den Jahren, die ich hier schon verbracht habe. Gut möglich, dass es schon immer da war... zum ersten Mal damit konfrontiert wurde ich jedenfalls kurz, nachdem uns im Wald die Leiche unseres Gruppenführers entgegengeflogen kam.“
„Ja, richtig...“, antworte ich gespannt. „Ihr wolltet mir ja noch erzählen, wie es danach mit eurer Geschichte weiter ging.“
Ich hasse Werbeunterbrechungen. Erst recht dann, wenn sie mit einem Nadelstich in meinen Nacken eingeläutet werden... und so hoffe ich, dass die nächste Unterbrechung schmerzfreier vonstatten gehen wird, und lehne mich entspannt, aber wachsam, zurück.
„Also... was ist nach dem Mord an Stauffer geschehen?“
Kapitel 4 - Die Suche nach Sarah Crohn.
„Nachdem wir endlich wieder in unserem kleinen Dorf angekommen waren, verabschiedete ich mich von Benja und eilte schnurstracks nach Hause.
Ich weiß noch, dass ich die ganze Nacht kein Auge zugetan habe. Die unheimliche Wahrsagerin, die Kutsche, die mich beinahe überrollt hätte, die blutverschmierte Leiche von Stauffer... und dann auch noch mein bester Freund, der so tat, als wäre das alles das Normalste auf der ganzen Welt. Kein Wunder, dass ich da innerlich total durcheinander war.
Am nächsten Morgen saß ich völlig übermüdet mit meiner Mutter, meiner kleinen Schwester und meinem Großvater am Frühstückstisch.
Zwar bemühte ich mich, mir nichts anmerken zu lassen... aber ich glaube nicht, dass mir das besonders überzeugend gelungen ist. Missmutig stocherte ich in meinem Spiegelei herum und starrte aus dem Küchenfenster hinaus auf die Straße.
Mein Vater war im Krieg, irgendwo in Russland. Seit Wochen hatten wir nichts mehr von ihm gehört, und so war das Klima zu Hause natürlich entsprechend unterkühlt.
„Du zerbrichst dir über zu vieles den Kopf.“, meinte mein Großvater, der gerade in eine lebhafte Diskussion mit meiner Mutter vertieft war.
„Dass dir Roland fehlt, ist verständlich. Glaub mir, ich vermisse ihn auch. Aber Krieg hat es nunmal schon immer gegeben, und wird es auch immer geben. Hitler ist schon der richtige Mann für unser Land... und ich denke, er weiß ganz genau, was er tut.“
Meine Mutter schüttelte skeptisch den Kopf
„Da draußen stimmt was nicht, Franz. Ich spüre es einfach. Die Tiere, die Luft, die Menschen... alles hat irgendwie an Unbeschwertheit verloren. Manchmal erscheint mir das ganze Land so unnatürlich. Selbst die Vögel singen andere Lieder als noch vor ein paar Jahren.“
„Pah. Als ob deine Vögel eine Ahnung von Politik hätten!“, erwiderte mein Großvater spöttisch. „So lange wir uns täglich Spiegeleier leisten können, sollten wir die Lage nicht überdramatisieren. Denk doch bloß mal an die Kinder... die wissen doch gar nicht mehr, was es heißt, hungern zu müssen. Und das ist für mich erst mal das Wichtigste.“
„Ich geh dann mal.“, meinte ich beiläufig, als ich Benja auf seinem Fahrrad die Straße hochbiegen sah.
Meine Mutter gab mir einen feuchten Schmatzer auf die Wange.
„Ist gut, Schatz. Pass auf dich auf!“
Ich hasste es, wenn sie das tat... fühlte ich mich dann doch immer wie der kleine Junge, der ich längst nicht mehr sein wollte. Angewidert wischte ich mir den Lippenstift aus dem Gesicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich abgesehen von diesen Kleinigkeiten echt wenig Grund hatte, mich über meine Eltern zu beklagen. Ganz im Gegensatz zu Benja.
„Hat er dich wieder gehauen?“, fragte ich traurig, als ich Benjas geschwollene Backe sah.
Wütend schwang er sich von seinem Fahrrad hinunter.
„Ich lasse mir nicht den Mund verbieten! So ein Tyrann... Manchmal habe ich echt den Eindruck, dass ich meinem Vater mehr Freude machen würde, wenn ich taubstumm und blind wäre.“
„Mir aber nicht... ich mag dich so, wie du bist.“, versuchte ich ihn ein wenig zu trösten.
„Eltern sind das Letzte, Basti. Das Hinterletzte! Außer deinen natürlich... die sind schwer in Ordnung.“
Er lächelte... und ich bedauerte, dass ich den Lippenstift meiner Mutter gerade eben erst so undankbar abgewischt hatte.
Benja lehnte sein Rad an unsere Hecke. Dann packte er mich hastig an der Schulter und zog mich in den kleinen Schuppen, in dem die Gartengeräte meiner Eltern untergebracht waren.
„Was ist denn los, Benja... was hast du?“, fragte ich, um den Grund für seine offensichtliche Überdrehtheit zu erfahren.
„Was los ist? Ich bin verliebt, mein Freund. Das ist los!“, triumphierte er.
Dann hielt er mir stolz ein kleines Foto vor die Nase, das er in irgendein blaues Tuch eingewickelt hatte.
Ich musste mich setzen. Das Bild zeigte ein Mädchen... ein ganz besonderes Mädchen. Lange, dunkle Haare, die um ihr Gesicht herum förmlich zu tanzen schienen... ein niedliches Näschen, und Augen, in denen man sich verlieren konnte...
„Die ist ja der Wahnsinn!“, entfuhr es mir unglaubwürdig.
„Sag, wer ist sie?“
Benja sah mich prüfend an.
„Ich frag dich das nur ein einziges Mal, Basti: Wenn du wüsstest, wo du dieses Mädchen finden könntest... würdest du mit mir hingehen?“
„Na klar, was für eine Frage! Natürlich würde ich das.“, erwiderte ich fest entschlossen... nichtsahnend, dass ich diesen Enthusiasmus gleich darauf bereuen sollte.
„Geht klar, das ist ein Wort.“, freute sich Benja, bevor er das um das Foto herumgewickelte Tuch entfernte. Das Foto war Teil eines Ausweises... des Ausweises, den ich noch gestern Nacht in der Hand eines Toten gesehen hatte.
„Nein...“, flüsterte ich leise. „Nein, Benja. Das ist doch völlig bescheuert.“
„Aber sie ist hübsch, oder?“
Ich stieß genervt einen Korb um, der gerade zufällig vor mir auf dem Boden stand. Eine Absage kam jetzt nicht mehr in Frage, so viel war klar... Ich kannte Benja gut genug, um zu wissen, dass er mich dann Tag und Nacht nicht mehr schlafen lassen würde. Das hatte er schon einmal getan... hat einfach die ganze Nacht über Steine an mein Fenster geworfen, der verrückte Kerl. Nur, um mir zu zeigen, dass ich ihn nicht so einfach aus meinem Leben drängen konnte, wenn mir mal irgendwas nicht passte.
„Ja, sie ist hübsch. Ich gehe mit... aber ich habe dann was gut bei dir, klar?“
„Natürlich.“, antwortete Benja freudestrahlend. „Du hast bei mir doch immer was gut!“
Zugegeben, ein wenig neugierig war ich natürlich auch... und so nahm ich Benja schließlich den Ausweis aus der Hand, um ihn ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen.
„Sarah Crohn“, stand unter dem Foto, „Geboren am 13.7.1927 in... Lübeck.“
„Verdammt Benja, das ist hunderte von Kilometern entfernt.“, machte ich ihm enttäuscht klar. „Wie hat du dir das denn vorgestellt?“
Aber Benja ließ sich nicht beirren.
„Na, denk doch mal logisch: Stauffer war auf dem Rummelplatz, um nach versteckten Juden und Zigeunern Ausschau zu halten. In einem Schaustellerwagen hat er dann schließlich auch welche gefunden. Er nimmt der hübschen Sarah den Ausweis ab, es kommt zu einem Handgemenge... dann gehen die Pferde durch, Stauffer verliert sein Gleichgewicht und fällt aus der Kutsche.
„Er hatte ein Messer in seinem Leib stecken.“, korrigierte ich Benja nüchtern.
„Wie auch immer... jedenfalls brauchen wir eigentlich nur die Kutsche zu suchen, und wir finden das Mädchen.“
„Oder den Messerstecher...“
Mir gefiel das Ganze immer noch nicht. Dennoch willigte ich letztendlich ein. Und das sicherlich nicht nur aus Freundschaft zu Benja heraus... sondern wohl auch, weil mir mein Leben zu diesem Zeitpunkt irgendwie gleichförmiger erschien, als es das eines fünfzehnjährigen Jungen eigentlich sein sollte.
Zuerst kehrten wir zum Rummelplatz zurück und fragten uns bei einigen der Schausteller durch. Ob vielleicht irgendjemand diese Kutsche kannte, oder etwas darüber aussagen konnte, was mit unserem Gruppenleiter geschehen war, nach dem wir ihn aus den Augen verloren hatten.
Von einem Kollegen von Benjas Cousin, einem stämmigen Besenwirten, bekamen wir schließlich den entscheidenden Tipp:
„Eine lange, grüne Kutsche? Die gehört sicher zu diesem komischen Wanderzirkus. Ein Haufen von Schaustellern, die allerdings größtenteils schon vor ein paar Tagen abgezogen sind. Gestern hab ich hier nur noch eine ihrer Schießbuden und ein paar Ponys gesehen. Ihr großes Zelt war jedenfalls nicht mehr da.“
„Haben sie ne Ahnung, wo die hin sein könnten?“, hakte Benja ungeduldig nach.
„Schönbrunn, glaub ich. Oder Altenkamm. Jedenfalls sind sie auf der Straße nach Süden gefahren.“
Wir bedankten uns bei dem Wirt und radelten davon. Schönbrunn, der nähergelegene der beiden Orte, war nichtsdestotrotz stolze 30 Kilometer entfernt... so dass wir uns schon mal auf eine mehrstündige Fahrt einstellten, zumal das Terrain in der Gegend ausgesprochen hügelig war.
Tatsächlich waren wir jedoch gerade mal halb so weit gekommen, als wir in einer nahen Waldlichtung mehrere Zelte und grünangestrichene Pferdewagen stehen sahen.
Wie beschlossen, unsere Räder erst mal sicherheitshalber hinter ein paar Brombeerbüschen zu verstecken und uns danach vorsichtig anzuschleichen.
Leise bahnten wir uns also einen Weg durch das Unterholz... bis wir schließlich nur noch wenige Meter von einem der Zelte entfernt in einem Gestrüpp kauerten.
„Mehr los als in unserem Dorf.“, flüsterte ich beeindruckt, als ich das geschäftige Treiben wahrnahm, das vor uns auf der Lichtung herrschte.
Immer wieder liefen Kinder, geschminkte Clowns oder irgendwelche Artisten an uns vorbei... und beinahe ein jeder von ihnen trug irgendwelche schweren Gegenstände von einem Ort zum anderen. Ganz offensichtlich schienen sie damit beschäftigt zu sein, ein bereits bis zur Hälfte aufgebautes, mächtiges Zirkuszelt zu vervollständigen.
„Am Besten, wir mischen uns mal unters Volk!“, rief Benja ungeduldig.
Ich wollte noch anmerken, dass ich das gelinde gesagt für eine scheiß Idee hielt... doch da war Benja auch schon aus unserer Deckung hervorgesprungen und lief seelenruhig auf einen der Wagen zu.
„Guten Tag, die Herren! Kann ich euch irgendwie behilflich sein?“, sprach uns kurz darauf eine strenge Stimme an... bevor wir auch nur die geringste Chance hatten, das Gelände ein wenig genauer zu inspizieren.
Ich drehte mich um und erkannte einen älteren Mann, vielleicht so um die fünfzig, mit einem schwarzen, spitz zulaufenden Bart, einem Zylinder und fremdländisch anmutenden Klamotten, von denen mir vor allem sein roter Umhang besonders ins Auge stach.
„Sind sie so was wie der Chef hier?“, wollte Benja neugierig wissen.
„Wenn du es so nennen willst...“, entgegnete der Alte. „Ich bin Cäsar, der Direktor dieses bescheidenen Etablissements.“
„Dann könnt ihr uns sicher weiterhelfen. Wir sind nämlich auf der Suche nach einem Mädchen... einer gewissen Sarah Crohn. Wir wollen ihr etwas zurückgeben, das sie unterwegs verloren hat.“
Zum Beweis streckte Benja dem Zirkusdirektor ihren Ausweis entgegen.
„Das... ist überaus galant, meine Herren. Aber sie müssen sich im Zirkus geirrt haben. Mir ist jedenfalls kein Mädchen mit diesem Namen bekannt.“
Cäsar blickte Benja mit stechenden Augen an... und es gehörte nicht gerade viel Menschenkenntnis dazu, um festzustellen, dass wir hier offensichtlich nicht besonders willkommen waren.
Entschlossen zog ich meinen Freund zur Seite.
„Hör mal, Benja: Lass uns gehen... der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Wir werden sicher irgendwo anders mehr Erfolg haben.“
Benja nickte.
„Ja, da hast du wohl recht.“
Dann wandte er sich wieder dem immer noch grimmig dreinschauenden Cäsar zu.
„Entschuldigen sie uns. Aber da dieser Flecken im Wald weder uns noch ihnen gehört, haben sie ja sicher kein Problem damit, wenn wir uns hier noch ein wenig umsehen...“
Wir wollten gerade zum Weitergehen ansetzen, als sich urplötzlich ein großes Wurfmesser mit einem pfeifenden Geräusch nur wenige Millimeter von meinen Schuhen entfernt in den Erdboden bohrte. Scheinbar noch im selben Moment sprang eine Gestalt von einem der nahen Bäume herab und stellte sich uns drohend in den Weg.
Der unbekannte Messerwerfer schien nicht sehr viel älter als wir zu sein... dennoch jagte mir irgendwas an ihm gewaltigen Respekt ein. Vielleicht waren es seine animalisch funkelnden Augen... oder seine langen, schwarzen, hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare, die ihn irgendwie fremdartig und gefährlich erscheinen ließen.
Jedenfalls wurde mir äußerst unwohl zu Mute, als er noch zwei Schritte näher an mich herantrat... so nah, dass ich seinen warmen, nach Knoblauch riechenden Atem in meinem Gesicht spüren konnte.
„Das hier ist Gabriel!“, meinte der Zirkusdirektor und begann, ohne mich zu fragen in meinen Hosentaschen herumzuwühlen.
„Er ist stumm und kann weder schreiben noch lesen... aber wenn er will, schneidet er euch mit seinen Messern noch aus zwanzig Metern Entfernung die Ohren ab. Ich schlage also vor, ihr seid kooperativ und lasst es nicht so weit kommen!“
Benja warf mir eine entschuldigende Geste zu. Er wusste ganz genau, dass ich sauer auf ihn war, weil er uns mit seinen tollen Ideen schon wieder nichts als Ärger eingehandelt hatte.
„Ihr stinkt nach HJ. Das rieche ich förmlich...“, knurrte Cäsar in einem verächtlichen Tonfall.
„Aber ich will fair sein: Ihr habt jetzt zwei Chancen, uns mitzuteilen, aus welchem Grund ihr wirklich hier seid. Wenn ihr mich belügt, schlitzt euch Gabriel auf, und wir verfüttern euch morgen an die Ponys. So einfach ist das.“
Ich musste schlucken. Der Zirkusdirektor schien es ganz offensichtlich ernst zu meinen.
„Wir... wir suchen das Mädchen, weil wir uns in sie verliebt haben!“, brach es schließlich aus dem jetzt auch nicht mehr besonders tapfer wirkenden Benja heraus.
Zuerst warf uns Cäsar einen strengen Blick zu. Doch dann fing er plötzlich an, herzhaft loszulachen.
„Ha, ha. Der war gut!“, meinte er und klopfte Benja fröhlich auf die Schulter... bevor er schlagartig wieder ernst wurde.
„Ok, das war die obligatorische Lüge. Jetzt habt ihr nur noch eine Chance, euren Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“
„Aber das ist doch die Wahrheit!“, schrie ich aufgebracht. „Verdammt, welchen Grund sollten wir denn sonst haben, euren gammeligen Provinzzirkus so genau unter die Lupe zu nehmen?“
„Sag du es mir.“, erwiderte Cäsar und machte eine drohende Handbewegung. „Und zwar jetzt sofort!“
Ich starrte wie gebannt auf das scharfe Messer, an dessen Klinge der junge Gabriel geradezu demonstrativ herumspielte. Selbst wenn wir einen anderen Grund gehabt hätten, uns hier aufzuhalten... er wäre mir in jenem Moment vor lauter Anspannung sicherlich nicht mehr eingefallen.
„Ähm... um die Wahrheit zu sagen:“, begann ich zögernd den Versuch einer Erklärung. „Wir haben den Pass bei der Leiche unseres Gruppenführers gefunden. Der ist uns letzte Nacht gewissermaßen zugeflogen... und wir… wir haben niemandem etwas davon erzählt...“
„Weil ihr seine Mörder selber entlarven und den ganzen Ruhm dafür ernten wolltet.“, unterbrach mich Cäsar.
„Nein.... ich schwöre es ihnen. Mit Mord und Mördern wollen wir nichts zu tun haben.“
„Nur mit Mädchen.“, fügte Benja leise hinzu.
Der Alte schien uns das Ganze nicht so richtig abzunehmen... und da sich inzwischen noch zahllose andere Zirkusleute um uns herum versammelt hatten, war an eine Flucht sowieso nicht mehr zu denken.
„Nun gut...“, meinte Cäsar schließlich nach einigem Überlegen.
„Gabriel soll entscheiden, was mit euch passieren wird.“
Das konnte doch nicht sein Ernst sein!
„Was?“, empörte ich mich lautstark. „Sie wollen diesen Halbaffen hier über unser Leben entscheiden lassen? Hören sie... wir haben ihnen nichts getan, und wir werden auch ganz sicher keinem was verraten, wenn sie uns laufen lassen.“
Gabriel kam noch näher an mich heran und ließ die Klinge seines Messers langsam über mein Gesicht gleiten. Dabei schnupperte er an meinem Hals... ähnlich wie ein wildes Tier, das Witterung von seiner Beute aufnahm.
Ich lehnte mich zurück, so weit ich konnte, und betete leise, dass er es sich anders überlegen würde. Und tatsächlich... schließlich steckte er sein Messer wieder in den Gürtel, sah ein letztes Mal zu Cäsar hinüber und ging dann wortlos davon.
„So sei es.“, murmelte der Zirkusdirektor und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter.
„Kommt schon, jetzt beruhigt euch wieder! Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Und für heute Abend seid ihr unsere Gäste.“
Mit gemischten Gefühlen folgten wir Cäsar. Er führte uns an einigen bunten Wagen vorbei zu einem großen, halbfertig aufgebauten Zelt.
„Ich glaube, er mag euch!“, meinte er, und deutete dabei mit einer Kopfbewegung auf den fast schon wieder gänzlich im Dickicht des Waldes verschwundenen Gabriel. Ich verzog ein wenig verärgert das Gesicht.
„Ach wirklich? Er hat aber eine komische Art, einem das zu zeigen.“
Cäsar blieb stehen und starrte verständnislos auf eine neben mir stehende, hölzerne Pferdetränke.
„So lange du nicht hier drin liegst, sondern das Recht hast, dich überall frei zu bewegen, solltest du Menschen wie Gabriel keinen Vorwurf daraus machen, dass sie so sind wie sie sind.“
Ich nickte nur stumm und verkniff mir jeden weiteren Kommentar zu dieser Angelegenheit... schließlich schienen wir jetzt ja mit einem Mal tatsächlich willkommen zu sein.
Kapitel 5 - Urlaub in Utopia.
Wenig später fand ich mich mit Benja an einem kleinen Holztisch im vorderen Bereich des großen Zeltes wieder. Neugierig wie zwei kleine Kinder beobachteten wir das uns fremd erscheinenden Treiben um uns herum, während uns ein tapsig wirkender Liliputaner zwei Gläser mit Traubensaft servierte. Keine Ahnung, was es war... aber da lag etwas in der Luft, was mir ungemein vertraut und warmherzig erschien.
„So, jetzt müsst ihr mal nicht stramm stehen und Fahnen schwenken.“, flüsterte uns der Kleine freundlich zu. „Heute marschiert die Parade für euch!“
„Was weiß einer wie du schon vom Fahnenschwenken?“, fragte ich ihn... und klang dabei gehässiger, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte.
„Genug, um es nicht tun zu wollen.“, erwiderte der Kleine ohne Groll in seiner Stimme.
„Schon Schopenhauer hat einmal gesagt: „Jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel: Auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein.““
„Dein Freund wird in diesem Land wohl nicht sehr alt werden.“, meinte Benja zynisch.
Daraufhin lehnte sich der Liliputaner mit seinen Ellbogen auf unseren Tisch und grinste triumphierend.
„Schopenhauer war ein großer Philosoph und starb 1860 in Frankfurt!“
„Siehste... ich sagte doch gleich, dass der Typ keine Zukunft hat.“, versuchte Benja, seine offensichtliche Unwissenheit mit Humor zu überspielen.
„Na, führt ihr schon die ersten Streitgespräche mit unserem Professor?“, hörten wir auf einmal Cäsars Stimme, der sich mittlerweile umgezogen hatte und der jetzt eher wie mein Großvater als wie ein mysteriöser Zirkusdirektor gekleidet war.
Ich konnte mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen.
„Professor? Ich sehe hier nur Clowns und Artisten.“
„Dann sieh genauer hin!“, forderte mich Cäsar auf. Noch bevor ich darauf etwas erwidern konnte, zwinkerte mir der Liliputaner-Professor freundlich zu.
„Glaubst du etwa wirklich, das hier wäre ein Zirkus?“
Dann schlappte er laut lachend davon und ließ mich und Benja mit ratlos auf Cäsar gerichteten Augen zurück.
„Nur die Ruhe.“, meinte dieser beschwichtigend.
„Ich werde euch alles erklären, wenn die Zeit dafür reif ist. Aber jetzt möchte ich euch erst einmal jemanden vorstellen.“
Er verschwand hinter der Zeltplane... nur um kurz darauf Hand in Hand mit einer jungen Schönheit zurückzukommen.
Es war wie Kino. Dieses zauberhafte Wesen tanzte förmlich an mir vorbei und setzte sich graziös auf den uns gegenüber befindlichen Stuhl. Wäre sie wie ein Gespenst durch mich hindurchgeschwebt... ich hätte sie kaum noch faszinierter anstarren können.
„Hey!“, stieß mich Benja von der Seite an. „Sarah hat dich gerade gefragt, ob du schon mal ein Mädchen gesehen hast.“
Ich musste weggetreten gewesen sein.
„Oh, nein, natürlich nicht. Das heißt, ich meine, ja...“, stammelte ich... krampfhaft darum bemüht, wenigstens meine Spucke bei mir zu behalten.
„Das ist Basti. Keine Angst... der ist nicht immer so. Nur wenn er verliebt ist.“
Ich trat Benja verärgert ans Schienbein.... auch wenn er mich ja eigentlich nur in Schutz genommen hatte.
Natürlich kam postwendend ein schmerzhafter Fußtritt zurück.
„Es ist einfach nur so, dass ich nicht geglaubt hatte, dass es dich wirklich gibt. Ich dachte, das Foto wäre dem Wunschtraum eines einsamen Fotografen entsprungen.“, bemühte ich mich angestrengt, ins Gespräch zurückzufinden.
Sarah sah mir längere Zeit tief in die Augen, dann verzog sie nachdenklich ihren rosaroten Mund.
„Du bist verrückt. Aber das weißt du ja wahrscheinlich schon.“
Benja nickte bestätigend und sah amüsiert in meine Richtung.
„Und du...“, meinte Sarah mit einem strengen Blick zu Benja gewandt, „Du bist vermutlich ein richtiges Großmaul! Das Großmaul und der Verrückte, der ihm folgt... zwei Jungs vom Lande. Irgendwie süß, aber leider ohne den Hauch einer Ahnung, in was für einer Welt sie eigentlich leben.“
Cäsar nahm sich einen Stuhl und gesellte sich nun ebenfalls zu uns.
„Sei nicht so hart, Sarah. Die beiden sind was besonders. Gabriel denkt das auch.“
„Ja, hör auf deinen Vater, Sarah. Wir sind besser, als der Stallgeruch unseres Dorfes vermuten lässt.“, fügte Benja überzeugend hinzu.
„Ich bin nicht ihr Vater.“, antwortete Cäsar ernst. „Ihr Vater ist vor einigen Wochen von einem SS-Kommando erschossen worden.“
Ich schluckte.
„Tut mir leid.“, flüsterte ich, ohne ihr dabei in die Augen zu sehen. „Das... das haben wir nicht gewusst.“
Sarah strich sich deprimiert die Haare aus dem Gesicht.
„Ja. Den Spruch werden eines Tages noch viele Menschen in diesem Land aufsagen.“
Sorglosigkeit kann etwas Wunderbares sein, wenn sie von allen Anwesenden geteilt wird. Doch wenn einer unter ihnen ist, der echte Sorgen und Probleme hat, zeigt sie ungeschminkt ihre hässliche Seite... die Ignoranz.
Ich meine, da saß dieses Mädchen, von dem wir eigentlich überhaupt nichts wussten... und wir gingen wie selbstverständlich davon aus, dass sie gut drauf war und unsere pubertären Anmachsprüche hören wollten. Das ist so, wie wenn man einem Menschen, der gegen Tierhaare allergisch ist, eine Katzenpfote als Glücksbringer schenkt... man bekommt eine Ladung Rotze ins Gesicht und muss das gutgemeinte Geschenk wieder mit nach Hause nehmen.
Ohne Worte kramte ich schließlich den Ausweis aus der Tasche und legte ihn neben Sarah auf den Tisch.
„Der gehört wohl dir...“, meinte Benja, der jetzt auch deutlich weniger fröhlich wirkte.
Sarah schaute kurz auf das Papier und steckte es dann hastig in ihre Tasche.
„Ich glaube, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ihr habt mich und den Zirkus vielleicht vor Schlimmerem bewahrt...“
Fast meinte ich, ein leichtes Schmunzeln auf ihren Lippen erkennen zu können.
„Es ist schon seltsam... da rettet ihr eine Prinzessin vor den braunen Unholden, und das, ohne überhaupt zu wissen, wer die Guten und wer die Bösen sind.“
„Nun, Edelmut und Dummheit müssen sich nicht unbedingt ausschließen.“, wagte Cäsar den Versuch einer Erklärung... und ich war mir damals nicht ganz sicher, ob ich darauf nun erfreut oder beleidigt reagieren sollte.
Benja rutschte mit dem Stuhl so weit es ging nach vorne, um mit seinem Kopf möglichst nahe an Sarah heranzukommen.
„Hey... du und der Clown, ihr stellt uns hier die ganze Zeit als Volltrottel hin. Aber ich frage euch: Wer war denn nun so dumm, sich mit dem deutschen Reich anzulegen? Wir ganz sicher nicht. Wir mögen den ganzen Nazischeiß auch nicht besonders... aber wir leben friedlich und ohne größere Probleme mit denen zusammen.“
„Ach, glaubst du etwa, die Leute, die verfolgt werden, sind einfach nur dumm und selbst daran schuld, hä?“, regte sich Sarah sichtlich auf. „Sieh dir unseren Professor an! Der ist ganz sicher nicht dumm... er hat einen IQ, der wahrscheinlich so groß ist wie der von dir und deinem Freund zusammen. Dennoch hätten sie ihn beinahe umgebracht... nur weil er anders aussieht als es der alte Friedrich oder sonst wer für schön befunden hat.“
„So habe ich das nicht gemeint.“, bemühte sich Benja, die Wogen zu glätten. „Ich habe doch nur gesagt, dass ihr euch mit dem, was gestern Nacht im Wald passiert ist, nicht gerade mit Ruhm bekleckert habt. Ihr begeht einen Mord und lasst gleich noch eure Adresse am Tatort zurück... so töricht sind wir in unserem ganzen Leben noch nicht gewesen!“
Sarah nahm Benja vorsichtig das Glas aus der Hand und trank einen kräftigen Schluck daraus.
„Irgendwann macht doch jeder mal was falsch, oder? Das ist eben eine menschliche Eigenart. Wirklich dumm ist nur der, der eine Dummheit begeht und diese dann hinterher nicht mal bedauert.“
„Weißt du... es ist oft gar nicht so leicht zu erkennen, was nun eine Dummheit war und was nicht.“, versuchte ich ihr meinen Standpunkt klarzumachen. „Es ist schließlich nicht so, dass im Himmel ein rotes Licht angeht und eine Alarmsirene ertönt, sobald man was Dummes gemacht hat.“
„Da hat der Schöpfer des Alls wohl etwas Wichtiges vergessen.“, meinte Cäsar lakonisch, bevor er aufstand und seinen Stuhl zurück an die Zeltwand stellte.
„Entschuldigt mich... ich muss mich um das Geschäft kümmern.“
Zwei Stunden und etliche Gläser Traubensaft später saßen wir immer noch mit Sarah an dem kleinen Tisch.
Wir hatten ihr von unserem Dorf erzählt, von dem ganzen Ärger, den wir immer wegen der Hitlerjugend hatten, und von Benjas unbeherrschtem Vater. Sarah meinte traurig, dass ihr Vater das genaue Gegenteil davon gewesen wäre... ein Buchhalter, sensibel und immer um das Wohl seiner Mitmenschen bemüht... und dass er nur umgebracht worden sei, weil er ein Jude war.
Natürlich glaubte ich ihr nicht.
Es wurden zwar diese blutrünstigen Lieder gesungen, wie ich Sarah erklärte... beim geselligen Zusammensitzen im HJ-Kreis, wenn der Alkohol in Strömen floss und die Zunge dementsprechend locker saß... aber es war ein Unterschied, ob man „Lasst die Messer flutschen, in den Judenleib“ sang, oder ob man dann auch tatsächlich so etwas tat.
„Wir leben nicht mehr im Mittelalter, Sarah. Überleg dir doch mal, was für große Denker unsere deutsche Nation schon hervorgebracht hat. Goethe, Schiller...“
„... und Schopenhauer!“, ergänzte mich Benja, um mit seinem neu erworbenen Wissen Eindruck zu schinden.
„Genau, der auch. Glaubst du, dass all diesen kulturellen Errungenschaften zum Trotz in unserem Jahrhundert noch eine solche Barbarei möglich sein könnte?“
Sarah sah mir eindringlich in die Augen.
„Lasst die Messer flutschen, in den Judenleib... das ist nicht von Goethe, oder?“
Ich schüttelte wortlos den Kopf.
„Habt ihr da auch mitgesungen?“
Mir fiel nichts ein, was ich darauf erwidern sollte. Natürlich hatten wir mitgesungen... irgendwie hatte ich da aber auch ein ganz anderes Bild eines Juden vor Augen gehabt als das, das mir jetzt gegenüber saß.
Glücklicherweise kam genau in diesem Moment Cäsar zurück an unseren Tisch.
„Hey, ihr beiden. Kommt mal mit! Ich will euch etwas zeigen...“
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Mit einem vielsagendem Lächeln entschuldigten wir uns bei Sarah und folgten dem merkwürdigen Zirkusdirektor... vorbei an Zelten und probenden Artisten, immer tiefer in sein kleines Reich hinein.
„Seht ihr den da?“, meinte er und zeigte auf einen jonglierenden Jungen, der noch um einiges jünger als wir zu sein schien.
„Das ist Toni. Noch vor einem halben Jahr war er auf einer Eliteschule der Nazis, in der ihn seine Eltern abgegeben hatten. Mit Stockschlägen und harten Strafmaßnahmen sollten ihm dort die preußischen Tugenden eingebleut werden... einem elfjährigen Knaben! Eines Nachts hielt er es nicht mehr aus und ist davongelaufen. Jetzt ist er hier bei uns... und ich glaube, dass er glücklicher ist als jemals zuvor in seinem Leben.“
Ich sah ihm noch eine Weile fasziniert hinterher. Konzentriert bemühte er sich darum, die um ihn herumkreisenden Bälle im Auge zu behalten. Vermutlich hatte er uns dabei nicht einmal bemerkt gehabt.
Als wir um die nächste Ecke bogen, entdeckten wir einen großgewachsenen Posaunenspieler.
„Und das hier ist Otto. Er wollte immer Musiker werden... doch in Zeiten der Rezession war ihm dies nicht möglich. Schließlich heuerte er bei einem Stahlkonzern an. Dort arbeitete er am Fließband... stellte metallene Stifte her, über deren Zweck er sich nie richtig im Klaren war. Erst, als ihm ein beinamputierter Veteran aus dem letzten großen Krieg darauf aufmerksam machte, dass Otto Bauteile für Minen herstellte, die großes Unheil über andere Menschen bringen würden, begriff er, dass er sein tägliches Brot vom Teufel auf den Teller gelegt bekam. Er kündigte kurzentschlossen und schlug sich als Straßenmusikant durch, bis er eines Tages auf unseren Zirkus traf.“
„Was genau seid ihr?“, wollte ich jetzt endlich von ihm wissen.
„Ist euer Zirkus eine Art Ersatz-Zuhause für Menschen, die nicht in der normalen Welt leben wollen?“
Cäsar lächelte.
„So würde es ein Hitlerjunge definieren. Für uns ist das hier die Normalität. Das letzte Fleckchen Vernunft in einer wahnsinnig gewordenen Welt.“
„Das heißt also... jeder kann hier sein, was immer er sein will? Ganz ohne Zwang?“, fragte Benja, den diese Vorstellung ganz offensichtlich zu faszinieren schien.
„Das ist die Idee von Utopia!“, erwiderte Cäsar. „Wenn die Gesellschaft im Großen noch nicht bereit dafür ist, dann wollen wir es wenigstens im Kleinen, in unserer eigenen Welt, ungestört leben und verbreiten können.“
Benja gab sich mit dieser Erklärung noch nicht zufrieden.
„Ja, aber... nicht jeder Mensch will jonglieren, Posaune spielen oder sich als Clown verkleiden. Muss man also Künstler sein, um bei euch aufgenommen zu werden?“
Cäsar blieb nachdenklich stehen... und erst jetzt erkannte ich, dass wir mittlerweile inmitten der großen Manege standen.
„Jeder Mensch ist ein Künstler.“, erklärte er, und deutete majestätisch auf die rund um uns herum geschäftig werkelnden Zirkusleute.
„Denn ein jeder Mensch hat etwas, was er so gut kann wie kaum ein anderer. Sarah zum Beispiel kann unwiderstehlich lächeln, auch wenn ihr momentan nicht oft danach zu mute ist... wenn sie freundlich ihre Lippen verzieht, ist das große Kunst.
Oder schaut euch nur mal Gabriel an. Er kann nicht sprechen... aber dafür ist er im Schweigen unschlagbar. Keiner vermag es so kunstvoll wie er seinen Mund zu halten.
Und selbst wenn jemand überhaupt nichts auf die Reihe bekommen würde... er würde doch zumindest atmen können. Ist das etwa nichts? Dass solche Fleischklumpen wie du und ich überhaupt leben können, das ist doch schon ein wundervolles Spektakel für sich. Wieso sollte ein Mensch dann noch unbedingt Violine zu spielen haben, um ein Künstler zu sein?“
„Vielleicht, weil man vom Atmen alleine nicht satt wird?“, fragte ich kritisch.
„Ach, Blödsinn!“, wiegelte Cäsar ab. „Wer nichts kann, was andere beeindruckt, der stellt sich halt an den Eingang und kassiert, oder er füttert die Tiere... wir haben hier noch für jeden einen Platz gefunden.“
„Und er? Was ist sein Platz?“
Benja deutete auf den mittlerweile in der Nähe von Sarah stehenden Gabriel... und ich bildete mir ein, dass er zu jenem Zeitpunkt ein wenig eifersüchtig auf den stummen Jungen war, der offensichtlich weitaus besser mit Sarah auszukommen schien als wir.
„Gabriel? Der hält uns die Kakerlaken vom Hals.“, erklärte Cäsar mit einem vielsagenden Lächeln.
Doch dann wurde sein Gesicht schlagartig ernster.
„Der Himmel weiß, was mit ihm los ist... eines Morgens stand er einfach da. Mit blutverschmiertem Gesicht und einem irren Blick in den Augen. Seitdem ist er hier der Mann fürs Grobe und tut das, was manchmal leider nötig ist, aber kaum einer von uns fertig bringen würde.“
„Wie den Mord an Heinz Stauffer?“, fragte Benja unverfroren.
Cäsar musterte meinen Freund streng von oben bis unten.
Zuerst schien es, als wollte er ihn zurecht weisen... doch dann besann er sich eines Besseren und fing an zu erzählen, was in der vorigen Nacht im Wald vor sich gefallen war.
Unser Gruppenleiter hatte sich demnach wohl in einen ihrer Wohnwagen geschlichen... hatte dort in den Schränken gewühlt und unglücklicherweise ein paar belastende Papiere gefunden. Er versteckte sich also, um zu sehen, wohin der verdächtige Wagen fahren würde.
Doch schon nach kurzer Fahrt wurde er von Sarah entdeckt.
Er bedrohte sie mit vorgehaltener Pistole und drohte, sie auf der Stelle zu erschießen... allerdings hatte er dabei seine Rechnung ohne den wie immer wachsamen Gabriel gemacht. Der verpasste ihm nämlich einen saftigen Kinnhaken, worauf sich ein ungewollter Schuss löste.
Vom Lärm aufgeschreckt gingen die Pferde durch... und der Kutscher hatte wahrlich seine Mühe damit, den Wagen auf der Strecke zu halten.
Innen entbrannte unterdessen ein wilder Kampf. Sarah hatte einen Tritt des Gruppenleiters einstecken müssen und war nach hinten gegen die Wand geprallt... während sich Gabriel verzweifelt an Stauffers Arm klammerte, um diesen nicht zum Zielen kommen zu lassen.
Mit seiner freien Hand griff Stauffer nach einer Dose, die neben ihm auf einer Ablage stand, und schlug damit mehrmals auf Gabriels Schädel ein.
Doch Gabriel konterte und verpasste Stauffers Kopf einen kräftigen Stoß, worauf dieser gegen die hölzerne Wandverkleidung krachte. Dann noch einmal, und noch einmal...
Als Stauffer schließlich orientierungslos zu schwanken begann, griff Gabriel blitzartig nach seinem im Hosenbund steckenden Messer und rammte es seinem Kontrahenten mitten ins Herz.
Dann schleuderte er ihn nach hinten gegen die Wagentüre... so stark, dass sie entzwei splitterte und Stauffer leblos aus der Kutsche flog.
„Kleinen Moment, ich muss hier gerade mal mit anpacken“, unterbrach Cäsar seinen Bericht, um einem Artisten beim Aufhängen eines schweren Netzes unter die Arme zu greifen.
Benja nutzte die Gelegenheit und zog mich daraufhin unauffällig zur Seite.
„Sag mal... was hältst du von dem ganzen Zeug hier?“
Ich vergewisserte mich mit einem prüfenden Blick, dass niemand unsere Unterhaltung belauschen konnte.
„Ich weiß nicht.“, antwortete ich zögernd. „Wenn Stauffer wirklich bei einem heftigen Kampf getötet wurde, wieso hatte er dann Sarahs Pass in der Hand? Wollte er seinen Gegner mit der Anmut ihres Fotos blenden oder so was?“
„Quatsch nicht rum!“, entgegnete Benja. „Ist mir doch scheißegal, was mit Stauffer passiert ist. Ich will wissen, was du von diesem Zirkus und seinen Bewohnern hältst!“
Ich stützte meinen Ellbogen auf Benjas Schulter und schielte melancholisch zu Sarah hinüber.
„Dir gefällt es hier, hab ich Recht?“
„Mensch, Basti... das ist vielleicht die Möglichkeit, auf die ich schon so lange gewartet habe! Utopia kommt wie eine Welle über uns und nimmt uns mit. Wie Strandgut, das schon zu lange im braunen Sand vor sich hingefault ist und jetzt die Weiten des Ozeans kennenlernen wird.“
Ich grinste.
„Verstehe... und du wirst in Zukunft poetische Gedichte schreiben und hier jeden Tag die Pferde striegeln, hab ich recht?“
„Nein.“, erwiderte Benja fasziniert. „Wir werden das zusammen tun, Basti. Ich will dich doch nicht alleine zurücklassen...“
„Moment mal!“, ereiferte ich mich, denn das ging mir alles um Einiges zu schnell.
„Wir wissen so gut wie nichts von diesen Leuten hier... noch dazu kommt, dass die uns doch ohnehin für geistig zurückgeblieben halten. Und meine Eltern... die würden ganz sicher auch etwas dagegen haben, dass ich einfach in einer solchen Nacht- und Nebelaktion verschwinde. Ich meine... einfach meine Heimat verlassen, nur weil mir manche Dinge hier nicht passen...“
Benja stieß mir wütend mit der flachen Hand gegen die Stirn.
„Verdammt, wach endlich auf! Wir sind doch längst Fremde im eigenen Land. Was Cäsar sagt ist wahr. Da draußen regiert der Wahnsinn... unsere Heimat hat die Tollwut.
Worauf willst du warten? Dass sie uns in den Krieg einziehen und nach Russland schicken? Denkst du, da können wir uns auch so einfach davonschleichen wie jetzt bei der HJ, wenn wir mal keinen Bock auf Schießen haben?
Menschen sind nicht dazu bestimmt, im Gleichschritt hintereinander herzulaufen... das fühle ich einfach, mit jedem Tag mehr, an dem ich mit den anderen mitmarschieren muss. Lass uns aus der Reihe tanzen, bevor wir uns irgendwo wiederfinden, wo wir eigentlich niemals hinwollten!“
Ich verstand, was er meinte... aber ich konnte nicht so ohne Weiteres alles aufgeben.
„Lass uns erst mal ne Nacht drüber schlafen, Benja.“, bemühte ich mich darum, etwas Zeit zu schinden. „Der Zirkus läuft uns schon nicht weg... ich wette, der bleibt hier noch ein paar Tage. Dann können wir uns ja immer noch entscheiden.“
Benja nickte.
„Ja, ist gut. Aber ich glaube nicht, dass mich noch mal irgendwas umstimmen könnte.“
Auf einmal nahm ich eine Bewegung in meinem Rücken wahr. Erschrocken drehte ich mich um... und blickte in das ausdruckslose Gesicht von Gabriel, der offensichtlich schon länger dort an der Zeltwand gelehnt haben musste.
„Ach du bist es...“, flüsterte ich. „Und ? Hat dir unser Gespräch gefallen?“
Es war mehr als offensichtlich, dass er bloß hier war, um uns zu belauschen.
„Du kannst deinem Herrn und Meister jedenfalls ausrichten, dass wir nicht vorhaben, irgendjemand anderem von eurem Zirkus zu erzählen.“
Er grinste... dann schlappte er wortlos davon, ohne weiter auf mich und meinen Freund zu achten.
„Was für ein komischer Kauz.“, raunte mir Benja zu. „Aber irgendwie hat er Stil.“
„Findest du? Ich weiß nicht... mir ist der Typ immer noch nicht ganz geheuer. Hast du gesehen, wie er uns angestarrt hat?“
Benja zuckte gelangweilt mit den Schultern.
„Naja... wie würdest du zwei Hitlerjungen anschauen, wenn du Jude wärst?“
„Was, ist er denn einer?“, fragte ich Benja irritiert.
„Oder Zigeuner.“, antwortete er achselzuckend. „Das macht doch keinen Unterschied.“
Draußen war es längst dunkel geworden, und ich begann Benja zu drängen, dass wir uns endlich auf den Heimweg machten... schon allein deshalb, damit zuhause niemand Verdacht schöpfen würde.
„Kommt ihr denn morgen Abend zu unserer Vorstellung?“, fragte Sarah, die sich mittlerweile wieder zu uns gesellt hatte.
Ich lächelte sie schüchtern an.
„Wie könnten wir uns das entgehen lassen? Klar kommen wir!“
„Lasst euch dann aber eine gute Ausrede einfallen, falls euch jemand fragt, was ihr vor habt.“, riet uns der kleine Professor. „Es hat im Deutschen Reich mittlerweile mehr Spitzel als Fliegen in einem Sumpf. Und irgendwo in einem Büro sitzt jemand, der Buch darüber führt, ob der Braten, den ihr zu Mittag gegessen habt, von einer arischen oder einer semitischen Kuh stammte.“
Grinsend klopfte ich ihm auf die Schulter... denn das konnte ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Aber ich versprach ihm dennoch, auf der Hut zu sein. In erster Linie, um ihn zu beruhigen... nicht, weil ich seine Vorsicht besonders ernstgenommen hätte.
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 6 - Böses Erwachen
Als ich nachts wieder in meinem Bett lag und keinen rechten Schlaf fand, bastelte ich mir eine eigene Theorie von Stauffers Tod zusammen.
Angenommen, Stauffer lag bereits hilflos und blutverschmiert auf dem hölzernen Boden der Kutsche, als sich Gabriels scharfes Messer in sein braunes Herz bohrte. Angenommen, er wurde regelrecht hingerichtet... als eine Art Ausgleich, Rache für Sarahs toten Vater, oder was auch immer.
Möglicherweise war es ja auch gar kein Versehen gewesen, dass er Sarahs Ausweis umklammert hielt. Vielleicht wurde der ihm nach seinem Tod absichtlich in die Hand gelegt. Um allen Judenhassern eine Botschaft zu schicken... eine Botschaft, dass die Juden zurückschlagen würden. Was, wenn dieser ganze Utopia-Zirkus nicht so harmlos war, wie man uns bei unserem ersten Treffen weismachen wollte?
Ich mochte Sarah und die anderen, daran bestand kein Zweifel. Doch alles in Utopia war viel zu frei, viel zu wild und viel zu ungezwungen, um mich nicht wenigstens ein kleines bisschen davor zu fürchten... auch wenn die Vorfreude auf den kommenden Abend letztlich weitaus stärker war als meine zahlreichen Bedenken.
Wir hatten einen Ehrenplatz in der ersten Reihe zugewiesen bekommen, so dass wir uns die Darbietungen der Artisten in aller Ruhe zu Gemüte führen konnten.
Die Vorstellung war ziemlich eindrucksvoll. Der Professor mimte den tollpatschigen Clown so gut, dass ich kaum glauben konnte, noch am Vortag mit ihm über Nationalstolz philosophiert zu haben.
Der junge Toni jonglierte wie ein Weltmeister, Sarah schritt elegant wie eine echte Prinzessin vor einer goldenen Wand auf und ab, und Gabriel... der warf mit Messern auf sie. Verdammt, das gefiel mir nicht! Einmal schleuderte er das Messer so, dass es sich in ihren braunen Haaren verfing und sie dadurch bewegungsunfähig an die Wand nagelte. Gabriel verzog keine Miene dabei... und es hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn er bei dem Mord an Stauffer ähnlich eiskalt geblieben wäre.
Ich erinnerte an die vielen Male, in denen ich als Kind schon in einem Zirkus gewesen war... und ich fragte mich, ob die Messerwerfer dort auch alle so merkwürdig draufgewesen waren. Doch dann nahm mich das Geschehen in der Manege schnell wieder so gefangen, dass ich nicht weiter darüber nachdachte.
Ich weiß noch, wie Sarah nach dem Ende ihres Auftritts ziemlich auffällig in unsere Richtung lächelte... und ich mich mit Benja darüber stritt, wem von uns beiden diese Geste nun gegolten hatte.
Schließlich einigten wir uns aber auf „Uns beiden“.
Nachdem die Vorstellung gelaufen und das Publikum nach Hause gegangen war, versammelten sich alle um ein großes Lagerfeuer inmitten der Waldlichtung. Allmählich wurde es auch dunkel... nur über den Hügeln, wo vor einiger Zeit die Sonne untergegangen war, schimmerte der Himmel noch in kräftigen Farben. Violett, blau und in einem seltsamen, magisch anmutendem Grün.
Der Duft von gebratenem Spanferkel zog in meine Nase und erinnerte mich daran, dass ich den ganzen Tag über noch nichts gegessen hatte. Dann wurde ein imposantes Bierfass angestochen, und es gab reichlich zu Trinken für alle.
„Feiert ihr nach einer gelungenen Vorstellung immer so heftig?“, fragte ich Sarah, die noch sichtlich außer Atem von der ganzen Anstrengung war und sich erschöpft zwischen mir und Benja fallengelassen hatte.
„Bei so vielen Leuten hat doch immer jemand Lust auf Feiern.“, erklärte sie mir und nahm sich ein Brötchen aus einem hinter uns stehendem Korb. „Wer zu müde dazu ist, der haut sich eben aufs Ohr und schläft.“
Ich schenkte mir ein Bier ein und nahm einen kräftigen Schluck, ohne dabei Sarah all zu lange aus den Augen zu lassen.
„Weißt du... ich bin es irgendwie gewohnt, dass man nur zu besonderen Anlässen feiert. Wenn es ein Jubiläum gibt, zum Beispiel, oder wenn es die Partei so angeordnet hat.“
„Wann es etwas zu feiern gibt, sollte einem einzig sein Herz sagen... und nicht der Kalender oder der beschissene Gauleiter.“, antwortete Sarah. „Ich wette mit dir: In fünfzig Jahren werden die jungen Menschen Feste feiern können, wann immer sie wollen. Ohne dass sich irgendwer daran stören wird!“
Diese Vorstellung gefiel mir.
„Aber sie werden es dann nicht mehr zu schätzen wissen.“, ergänzte der Professor amüsiert, der sich mittlerweile zu uns gesellt hatte.
„Sie werden vielmehr ständig mit einem Bierkrug in der Hand herumlaufen und gröhlen: „Früher war alles besser!““
Ich schüttelte grinsend den Kopf.
„Glaubst du wirklich, dass die Menschen so dumm sein könnten?“
„Das Problem ist doch das folgende:“, versuchte der Professor zu erklären. „Freiheit beinhaltet ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Frei zu sein, das bedeutet auch, dass man Verantwortung für sein Leben und seine Umwelt übernimmt... dass man sich für oder gegen etwas entscheiden muss, und dass man die Konsequenzen für sein Handeln selbst zu tragen hat.
Geistig noch nicht ausreichend entwickelten Menschen macht eine solche Entscheidungsfreiheit Angst. Sie fürchten, dem allem nicht gewachsen zu sein... und so würden sicher manche liebend gerne auf das Recht, jeden Tag feiern zu können, verzichten, wenn sie dafür nur wieder jemanden hätten, der ihnen Befehle gibt und sagt, wo es lang geht.“
„So habe ich das noch gar nicht betrachtet...“, antwortete ich nachdenklich.
Vielleicht war es eine Art Tauschhandel. Die Nazis machten sich die Mühe und dachten für die Menschen mit... und diese nutzten im Gegenzug einen Teil der dadurch gewonnenen Zeit, um für die Nazis zu arbeiten.
In gewisser Weise das alte Motto: Arbeit macht frei. Sofern man es überhaupt als Freiheit bezeichnen konnte, wenn man von kreativen Gedanken und Eigenverantwortung befreit war. Eigentlich war das doch eher das genaue Gegenteil davon.
„Gib mir deine Bäckerei, und ich gebe dir dafür täglich einen Laib Brot.“
Ein ziemlich perfider Tausch... Dumm und kurzsichtig der, der darauf einging.
„Ich glaube, langsam verstehe ich euch.“, flüsterte ich, und ließ meinen Blick durch die ausgelassen tanzende Menge schweifen.
Ein alter Zigeuner spielte Gitarre und sang dazu herzergreifend, während einige jüngere Leute im Takt der Musik um das Feuer herumtanzten. Ich erkannte Toni, Otto und die anderen, die mir Cäsar vorgestellt hatte. Nur Gabriel konnte ich nirgendwo ausmachen.
„Wo ist denn euer Messerwerfer?“, fragte ich den Professor.
Der schmunzelte nur und deutete nach hinten zu den Wagen.
„Der edle Herr Gabriel zieht es für gewöhnlich vor, nicht mit dem Pöbel zu feiern. Er sitzt vermutlich wie immer in seinem Schlafgemach und vertreibt sich die Zeit mit einer Flasche Absinth.“
„So lange er das nicht macht, bevor er mit dem Messer auf Sarah wirft...“, meinte ich kopfschüttelnd.
„Hast du etwa Angst um mich gehabt?“
Sarah legte behutsam ihre Hand auf meine Schulter.
„Das ist echt süß von dir. Aber Gabriel weiß schon, was er tut.“
Ich lehnte meinen Kopf an ihren, und versuchte unterdessen, das Gespräch mitzuhören, das Benja gerade mit Cäsar führte.
„Also dann haben sie den ganzen Laden hier gegründet?“, fragte er den Zirkusdirektor. Doch der verneinte.
„Utopia existiert schon unendlich lange. Vielleicht schon genau so lange, wie es Unterdrückung und Faschismus gibt... wer weiß. Vier Generationen lang ist Utopia jetzt schon ein Zirkus. Davor gab es Nomaden, die so lebten, Bauern, Goldgräber... und einmal besaßen die Anhänger von Utopia sogar eine eigene Burg.“
Benja strahlte begeistert.
„Was, eine eigene Burg? Das ist ja stark! Gibt es heute noch andere Utopias, oder ist dieser Zirkus momentan das einzige?“
Cäsar zuckte ratlos mit den Schultern.
„Ich glaube, dass es noch mehr gibt. Aber wie sollten wir sie finden? In der Zeitung inserieren? Vielleicht kann Utopia ja nur funktionieren, wenn es verborgen bleibt. Denn wann immer es größere Ansiedlungen von Unseresgleichen gab, wurden sie über kurz oder lang von unverständigen Nachbarn zerstört.“
„Aber... es darf nicht verborgen bleiben!“, ereiferte sich Benja. „Sind die Nazis etwa im Verborgenen geblieben? Nein! Sie sind schon seit ewiger Zeit auf die Straße gegangen und haben ihre Banner stolz in die Luft gehalten. Vielleicht solltet ihr das ja auch tun...“
„Hab Geduld, Junge. Die Herrschaft der Nazis wird vorübergehen... aber Utopia wird es auch in zweihundert Jahren noch geben. Unsere Art zu leben ist der nächste Schritt in der Evolutionsleiter, davon bin ich fest überzeugt... und über kurz oder lang werden mehr und mehr Menschen zu dieser Erkenntnis gelangen. Auch ohne, dass wir mit Trommeln und Trompeten durch die Straßen ziehen müssen.“
Ich hatte mich von den anderen abgesetzt, da ich ein wenig Ruhe brauchte, und ging nachdenklich an den verlassenen Zelten vorbei.
Über den Baumwipfeln war längst der schwarze Nachthimmel zu sehen, der durch Sterne und vereinzelt vorbeiziehende, hellgraue Wolken nur spärlich erleuchtet wurde. Für einen Moment ertappte ich mich bei der Überlegung, wie schön es wohl sein würde, jeden Abend so im Freien sitzen und Spanferkel essen zu können. Jedenfalls konnte ich mich der Tatsache, dass mir dieser Ort immer mehr gefiel, nur noch schwerlich entziehen.
In einem Wagen am Rande des Waldes brannte ein helles Licht... und da die Türe halb offen stand, entschloss ich mich dazu, einmal einen Blick in das Innere einer solchen Artisten-Wohnstube zu werfen. Ich stieg also vorsichtig auf die hölzerne Stufe und erklomm das Gefährt... neugierig auf das, was mich darin erwarten würde.
„Hallo. Ich wollte mich nur mal ein wenig umsehen.“, meinte ich beschwichtigend, als mich als Erstes der stechende Blick von Gabriel traf, der etwas unmotiviert an einem kleinen Tisch saß und sich ein Glas mit grüner Flüssigkeit hinter die Binde kippte.
Er reagierte nicht... also trat ich einen Schritt näher an ihn heran.
„Du stehst wohl nicht besonders auf Musik und Tanz?“, fragte ich leise. „Aber wahrscheinlich wird es auch langweilig, wenn man das jeden Tag haben kann... Für mich ist das alles hier ja irgendwie wahnsinnig aufregend.“
Noch immer der gleiche Blick in seinen Augen. Dann stellte er das Glas auf den Tisch und lehnte sich langsam zurück.
„Tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde von hier, Hitlerjunge! Sonst wirst du in deinem ganzen Leben niemals wieder so glücklich sein wie jetzt.“
Ich starrte ihn verwundert an.
„Du... kannst sprechen?“
Er grinste.
„Habe ich jemals etwas anderes behauptet?“
Zögernd schüttelte ich den Kopf.
„Nein... natürlich nicht... aber Cäsar hat doch gesagt...“
„Cäsar ist ein verfluchter Idealist!“, erwiderte Gabriel, und forderte mich mit einem Wink dazu auf, mich auf die Pritsche gegenüber von ihm zu setzen.
„Einer, der glaubt, alles wäre so einfach, verstehst du? Er sieht mich nie reden, also glaubt er, ich wäre stumm... Er sieht einen dahergelaufenen, blutverschmierten Zigeuner, und er glaubt, dass der Kerl ein armes Opfer ist, dem man Zuflucht gewähren müsste. Aber... genauso gut hätte dieser vermeintliche Zigeuner gerade eben seine ganze Familie aufgeschlitzt haben können.“
Ich verstand nicht ganz, worauf er hinaus wollte, und warum er mir das auf einmal erzählte.
„Und?“, fragte ich vorsichtig. „Hat er es denn?“
Wieder grinste Gabriel... dann griff er in seine Tasche, um sich ein kleines Tabaketui zu angeln, aus dem er eine kleine selbstgedrehte Kippe entnahm.
„Das Leben ist wie das Rauchen einer Zigarette.“, erklärte er mir, nachdem er sie entzündet hatte und mir genüsslich den Qualm ins Gesicht blies. „Du denkst, du hast ne tolle Zeit... doch in Wahrheit atmest du nur schlechte Luft. Und irgendwann fällst du tot um.“
Ich hatte gewisse Schwierigkeiten, seine Gedankensprünge nachvollziehen zu können.
„Wie meinst du das?“
„Ich meine... der Zirkus ist das Beste, was den Leuten hier passieren konnte. Und manchmal ertappe ich mich sogar dabei, wie ich mich für sie freue. Doch sie sind alle blind für die Realität. Du fragst dich, warum ich nicht mit den anderen rede, warum ich den stummen Messerwerfer spiele?“
Ich nickte, erwartete jedoch ehrlich gesagt kaum eine vernünftige Antwort von ihm.
„Weil Sprache eines der wichtigsten Merkmale ist, das die Menschen von den Tieren unterscheidet.“
„Und... du willst kein Mensch mehr sein?“, schlussfolgerte ich aus seiner Erklärung verdutzt.
„Hey, du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst, Hitlerjunge!“, entgegnete Gabriel und nickte mir anerkennend zu.
„Menschen sind dazu verdammt, traurig zu sein. Doch wie sehr traurig, das kannst du nicht einmal ansatzweise erahnen, selbst wenn du es wolltest. Weißt du was? Ich ertrage das alles nicht mehr! Ich will stumm sein, ohne Moral, und ohne Erinnerungen. Wie eine Hyäne... allerhöchstens noch den Schmerz spüren, wenn sich eine Kugel in meiner Brust verfängt. Aber nicht mehr diese Traurigkeit, diese verdammten, unnötigen seelischen Schmerzen. Stell dir vor, einer Mutter stirbt ihr Kind an den Masern weg. Ihr Weinen wird durch das ganze Dorf hallen... stundenlang, jede Nacht, immer wieder.
Wenn dagegen das Kind einer Hyänenmutter stirbt, wird sie verwundert an dem Kadaver riechen, ein wenig mit ihrer haarigen Schnauze dagegen stoßen... und wenn nichts geschieht, wird sie einfach davongehen und das nächste Kind zeugen. Ohne lange zu klagen. Ja, vielleicht wird sie den kleinen Leichnam sogar aufessen, wenn sie gerade hungrig ist. Und wenn sie eines Tages das Zeitliche segnet, wird auch niemand über sie klagen.“
„Das ist doch... pervers.“, antwortete ich verwirrt.
„Nein! Das kommt dir nur so vor. In meinen Augen wäre es viel perverser, wenn Gott der Hyäne so viel Verstand gegeben hätte, dass sie anfangen muss, sich über so eine Scheiße Gedanken zu machen. So, wie wir es gerade tun.“
Ich überlegte eine Weile, was ich von dieser seltsamen Philosophie halten sollte. Irgendwie gefiel sie mir nicht, auch wenn ich damals nicht genau ausdrücken konnte, wieso.
„Warum erzählst du mir das alles, Gabriel? Wo du es doch sonst auch keinem erzählst...“, fragte ich.
Er warf mir einen strengen Blick zu.
„Weil ich dir und deinem Freund klarmachen will, dass ihr hier nicht das Paradies gefunden habt! Utopia ist ein genialer Ort, um sich auszuruhen... um Kraft zu tanken und sich den Stress mit den ganzen dummen Mitmenschen zu ersparen. Aber, und das sage ich nur ein einziges Mal: Auch Utopia wird euch nicht von der perversen Natur des Lebens erlösen.“
Ich fing an, mich ziemlich müde zu fühlen. Außerdem schien die Luft in dem kleinen Wagen allmählich etwas stickig zu werden... und so stand ich langsam auf und entschuldigte mich.
„Erzähl das Benja und den anderen... nicht mir. Für mich ist das alles ein wenig viel auf einmal. Und an ein Paradies glaube ich ohnehin nicht. Ich denke, ich werde mich langsam mal auf den Heimweg machen.“
Gabriel packte drohend einen Zipfel meines Hemdes.
„Nur damit das klar ist, Hitlerjunge: Wenn du irgendjemandem erzählst, dass wir uns unterhalten haben, bist du tot!“, flüsterte er.
„Mann, wenn du nicht willst, dass ich dich verrate, dann halte das nächste mal einfach deinen Mund.“, entgegnete ich, und riss mich ein wenig verärgert von ihm los. „Aber falls es dich beruhigt: Von mir wird niemand was erfahren!“
Dann ging ich kopfschüttelnd zur Tür und lies ihn mit seinen Absinth-Gedanken alleine.
Seltsam... irgendwie hatte ich keine Angst mehr vor ihm. Ich fühlte eher so etwas wie Mitleid. Schließlich verpasste er gerade ein fröhliches Fest. Und das nur, um über die Moralvorstellungen von Hyänen nachzudenken.
Ich musste Benja regelrecht mit Gewalt von Cäsar und den anderen losreißen.
Aber auch, wenn es mir hier ziemlich gut gefiel, und ich gerne noch etwas länger mit Sarah geplaudert hätte, änderte das nichts an der Tatsache, dass wir noch einen langen Nachhauseweg vor uns hatten. Also verabschiedeten wir uns von unseren neugewonnenen Freunden... natürlich mit dem Versprechen, sobald es uns möglich war wieder zu kommen.
Als wir wenig später an den nach Heu duftenden Feldern vorbeiradelten, wusste ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr so richtig, wohin ich gehörte. Meine Eltern liebten mich... aber sie hatten vermutlich nicht den richtigen Durchblick. Die Leute im Zirkus dagegen blickten durch. Aber ich war mir nicht sicher, in wie weit ich ihnen etwas bedeutete.
Sie schienen ja ohnehin fast jeden so freundlich aufzunehmen wie uns... selbst einen so dermaßen merkwürdigen Typen wie diesen Gabriel.
In der darauffolgenden Nacht hatte ich einen heftigen Traum.
Ich befand mich irgendwo im Wald auf einer Lichtung. Menschen tanzten und sangen um mich herum... zwar konnte ich keine Gesichter erkennen, doch ich war mir sicher, dass es sich um die Bewohner des Zirkus handeln musste.
Noch bevor ich aber einen von ihnen genauer betrachten konnte, wurde die friedliche Idylle durch einen lauten Knall zunichte gemacht.
Dann begann irgendjemand zu schießen. Laut und schnell hintereinander... wie mit einem Maschinengewehr. Um mich herum sackten Menschen wahllos getroffen zusammen. Panik machte sich breit.
Die anderen tanzten immer noch. Ich versuchte, sie zu warnen... doch jedes Mal, wenn ich einen von ihnen ansprach, wurde er von unsichtbaren Kugeln niedergestreckt. Wie in Zeitlupe fielen alle, auf die sich meine Augen richteten, gleich darauf zu Boden.
Ich versuchte, meine Augen zu schließen, in der Hoffnung, dass es dann keinen mehr treffen würde... doch es gelang mir nicht. Irgendetwas schien meine Augenlider mit Gewalt offen zu halten.
Ein Mann prallte taumelnd gegen meine Knie, reckte bittend die Hand in den Himmel... bevor ein Schuss direkt in die Stirn auch ihm den Rest gab.
„Hört endlich auf!“, schrie ich in die dunkle Nacht hinaus... doch das Massaker ging ohne Unterlass weiter.
„Basti, bitte hilf mir!“
Es war Sarah, die zu mir rief. Sie stand einige Meter von mir entfernt und wirkte genauso verloren wie ich.
Ich versuchte verzweifelt, mich zu ihr durchzukämpfen... doch vor mir war alles voller Leichen. Mit meinen Füßen trampelte ich über die Gesichter der Toten, ohne wirklich voran zu kommen. Nach jedem Schritt schien einer von den Gefallenen nach mir zu greifen und mich festhalten zu wollen.
Hilflos starrte ich über das Schlachtfeld hinweg in Sarahs angstvolle Augen. Dann sah ich mehrere Soldaten auf sie zulaufen. Sarah schlug einem von ihnen ins Gesicht und trat wild um sich, doch schließlich wurde sie von einer hinter ihr stehenden Wache gepackt und brutal festgehalten. Sofort kamen die anderen dazu und begannen, mit ihren Knüppeln auf sie einzuprügeln.
„Lasst sie los, ihr Schweine!“, schrie ich außer mir.
„Psst! Sei leise, sonst erwischen sie dich auch noch.“, hörte ich eine mahnende Stimme unter mir. Ich blickte auf den Boden, und sah unter den ganzen Leichenbergen einen kleinen Jungen sitzen, der mich auf den ersten Blick stark an den jonglierenden Toni erinnerte.
„Komm runter und versteck dich, bis es vorbei ist. Dann denken sie, du wärst schon längst gestorben... so wie ich.“
Ich ging in die Knie, um mir den Knaben genauer anzuschauen. Seine Haut wirkte seltsam blass und matt, und zwei tiefe, dunkle Löcher gähnten da, wo sich früher seine Augen befunden hatten.
„Was zum Teufel ist hier los?“, fragte ich ihn, ohne mich allzu sehr über sein Aussehen zu erschrecken.
„Woher kommen all die Soldaten?“
„Das weißt du wohl selber am Besten.“, antwortete er grimmig. „Schließlich bist du ja auch einer von ihnen.“
Erschrocken sah ich an mir herunter. Verdammt, er hatte Recht. Ich trug die selbe Uniform wie die anderen!
„Du hast sie sogar hierher geführt.“, sprach der Knabe weiter. „Jetzt sieh, was du angerichtet hast!“
Ich erhob mich langsam, um über die zahllosen Leichen hinwegsehen zu können. Rings um mich war alles voller Soldaten. Sie trieben die wenigen Überlebenden zusammen, und schlugen ihnen dabei nach beinahe jedem zweiten Schritt mit ihren Gewehrkolben auf den Rücken.
Jetzt erkannte ich auch Cäsar, Otto und den kleinen Liliputaner-Professor unter den Gefangenen. Sie blickten vorwurfsvoll in meine Richtung, bis sie schließlich unter Schlägen und Fußtritten zum Weiterlaufen gezwungen wurden.
Erst in diesem Moment registrierte ich, dass ich ein Gewehr in der Hand hielt. Wütend legte ich an und nahm einen der Soldaten ins Visier, der gerade auf einen seiner Gefangenen einprügelte. Ich war fest entschlossen, es diesem feigen Hund heimzuzahlen, und drückte den Abzug.
Ein lauter Knall ertönte... dann schien mich ein frostiger Windstoß zu umklammern. Ich öffnete erschrocken meine Augen.
Die Türe nach draußen auf den Balkon stand sperrangelweit offen. Ich konnte mich allerdings nicht erinnern, sie aufgelassen zu haben. Anscheinend tobte draußen ein schwerer Sturm, denn ich hörte deutlich das Klappern der Fensterläden im Hintergrund.
Offensichtlich hatte ich nur einen Alptraum gehabt. Erleichtert wischte ich mir den Schlaf aus den Augen.
Doch ich hörte noch etwas. Ein klopfendes, schabendes Geräusch... es schien von irgendwo unterhalb zu kommen.
Ein wenig ängstlich schielte ich über die Bettdecke hinweg. Das Zimmer lag komplett im Dunkeln, nur der Vorhang vor der Türe bewegte sich verspielt im Rhythmus des Windes.
Da war wieder dieses Geräusch! Ein Schaben, vielleicht auch ein Stöhnen...
Ich setzte mich auf und beugte mich vorsichtig über die Bettkante. Doch ich konnte nichts erkennen. Nur den hölzernen Fußboden, auf dem ich meine Pantoffeln deponiert hatte.
Gerade, als ich alles als bloße Einbildung abtun wollte, sah ich auf einmal diesen dunklen, großen Schatten mitten in meinem Zimmer stehen.
„Wer... wer bist du?“, rief ich deutlich unter Schock stehend und versuchte, die Nachttischlampe zu erreichen. Doch die Gestalt ließ mich nicht dazu kommen. Sie warf sich auf mich und... drückte mir einen dicken Kuss auf die Wange.
„Das wollte ich schon immer mal ausprobieren.“, hörte ich eine vertraut klingende Stimme in mein Ohr flüstern.
Es war Benja.
„Verdammt, spinnst du jetzt total? Du hast mich beinahe zu Tode erschreckt!“, empörte ich mich... allerdings recht leise, damit meine Eltern nichts davon mitbekamen.
Ich machte das Licht an und starrte in Benjas grinsendes Gesicht. Dann bemerkte ich, dass sein linkes Auge ziemlich dick angeschwollen war.
„Hat dich... dein Vater wieder geschlagen?“, fragte ich nachdenklich.
Benja nickte.
„Ja, aber zum letzten Mal! Ich hab eine Vase über seinem Schädel zusammengehauen. Dann habe ich sein Motorrad im Fluss versenkt und bin hierher zu dir gelaufen.“
Erst jetzt sah ich, dass seine Klamotten völlig durchnässt waren.
„Naja, ich habe es eher unfreiwillig dort versenkt. Eigentlich wollte ich es ja mitnehmen. Es war aber so verdammt dunkel da draußen...“
Ich reichte ihm erst mal eine meiner Hosen zum Anziehen rüber. Ein wenig wehmütig beobachtete ich ihn dabei, wie er sich auf mein Bett setzte und seine nassen Kleider auszog.
Irgendwie war mir klar, dass er jetzt endgültig mit seinem Zuhause abgeschlossen hatte... genau wie mit der HJ, dem Dorf, und den ganzen Orten, die uns zwei so viele Jahre lang miteinander verbunden hatten.
„Du kommst nicht mehr zurück, hab ich Recht?“, fragte ich und warf ihm einen traurigen Blick zu.
„Zu meinem Vater zurück kann ich jedenfalls nicht mehr.“, antwortete Benja bestimmt. „Ich will aber auch nicht ohne dich von hier fortgehen.“
Ich fluchte leise. Jetzt war genau das eingetreten, wovor ich mich am allermeisten gefürchtet hatte.
Ich musste eine Entscheidung treffen. Ein Leben als Hitlerjunge, der von seinen Eltern geliebt wird, oder ein Leben als fahrender Gaukler, der keine Eltern mehr hat. Ein Leben an der Seite meines besten Freundes, oder ein Leben in der Ungewissheit, dass mein bester Freund irgendwo durch die Lande zieht und ich nie mehr mit ihm zusammen lachen und weinen kann, wenn mir danach ist.
Leise seufzend starrte ich auf die dunkle Straße hinaus.
„Ich werde mich entscheiden, wenn der Zirkus weiterzieht, in Ordnung? So auf die Schnelle kann ich das einfach nicht...“
Benja nickte.
„Geht klar. Aber ich sollte mich langsam auf den Weg machen. Ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis mein alter Herr deinen Eltern die Bude einrennt, um mich hier mit Gewalt rauszuholen.“
„So weit lassen wir es nicht kommen!“, entgegnete ich.
„Außerdem... ich kann gerade ohnehin nicht so richtig schlafen. Ich fahre mit dir zum Zirkus. Für meine Eltern wird mir morgen dann schon irgendeine Ausrede einfallen.“
Wir machten uns also abermals auf den Weg... Kilometerlang durch den Wald, mit unseren klapprigen Fahrrädern, die einen jeden größeren Stein schmerzhaft am Hinterteil spüren ließen.
Als wir in die Nähe der Lichtung kamen, wurde es bereits langsam wieder hell. Noch immer lag der Duft des Feuers in der Luft. Allerdings empfand ich ihn auf einmal nicht mehr als so angenehm wie noch einige Stunden zuvor.
„Scheiße, da stimmt was nicht!“, fluchte Benja und hielt mich hastig zurück.
Vor uns erschien ein heller Lichtkegel aus der Dämmerung... und er kam rasch näher. Kurzentschlossen packten wir unsere Fahrräder und versteckten uns mit ihnen im nahen Unterholz.
Das Licht wurde stärker, und auf einmal waren auch dröhnende Motorgeräusche zu hören. Dann fuhr ein großer Lastwagen an uns vorbei.
Kurz darauf noch mal zwei. Sie schienen der Wehrmacht zu gehören.
Benja hielt es nicht mehr in unserer Deckung. Er ließ sein Rad links liegen und stolperte aufgeregt durch den jetzt wieder völlig im Dunkeln liegenden Wald.
Natürlich setzte ich ihm hinterher. Doch erst, als wir endlich an der Lichtung ankamen, gelang es mir, ihn wieder einzuholen.
Das Erste, was ich sah, waren die niedergerissenen Zelte.
Die Wagen, deren bunte Verzierungen mir am Tag zuvor noch so imponiert hatten, waren komplett ausgebrannt. Nur vereinzelt züngelten noch einige Flammen aus den Überresten hervor.
Ich konnte das alles nicht glauben.
Dann fielen Schüsse.
Erschrocken sah ich in Benjas Gesicht, dem es keinen Deut besser zu gehen schien als mir.
Ich musste an meinen Traum denken... Geschah jetzt genau das selbe in der Realität?
Abermals wurde gefeuert... und ich bildete mir ein, auch den Schrei eines Kindes gehört zu haben.
Ohne noch weiter auf meine zur Vernunft mahnende innere Stimme zu hören, sprang ich auf und stürzte Hals über Kopf aus unserer Deckung hinaus auf die Wiese... mitten vor den Lauf eines stämmigen Soldaten, der dort offensichtlich Wache gehalten hatte.
Ich streckte panisch meine Hände in die Luft, und schaute zurück in den Wald, um zu sehen, wo Benja abgeblieben war. Doch außer dunklen Bäumen und dichtem Gestrüpp konnte ich dort nichts erkennen.
„Was machst du hier?“, herrschte mich der Soldat an, der ganz offensichtlich fast ebenso nervös zu sein schien wie ich.
„Los, mitkommen!“
Er ging drohend ein paar Schritte auf mich zu. Dann verpasste er mir einen brutalen Stoß, der mir unmissverständlich klar machte, wie ernst es ihm mit seiner Forderung war.
Hilflos gehorchte ich ihm... und konnte instinktiv fühlen, dass ich mit einem Mal ganz gewaltig in der Scheiße saß.“
Kapitel 7 - Saphire Rage.
Das aufdringliche Klingeln seines Handys unterbricht den alten Bastian jäh in seinen Erzählungen.
Er entschuldigt sich bei mir und erhebt sich hastig von seinem Platz. Während er am Telefon spricht, schleicht er wie ein hungriger Tiger um den großen Tisch herum... doch seine Laune scheint mit zunehmender Gesprächsdauer immer schlechter zu werden. Besorgt schaut er hin und wieder zu mir und den anderen. Dann nickt er mehrmals und legt nachdenklich auf.
Sämtliche Gespräche um den Tisch herum verstummen, und zahlreiche Augenpaare richten sich neugierig auf Bastian.
„Die Bombe wird morgen hochgehen!“, meint er mit finsterer Mine, bevor er langsam zu seinem Platz zurückhumpelt.
„Und zwar in einem Bürokomplex der Staatsanwaltschaft Berlin, kurz vor der Mittagspause. Ich muss euch nicht extra sagen, dass das verdammt knapp werden dürfte.“
Sofort herrscht rege Betriebsamkeit in dem kleinen Saal. Alle scheinen es plötzlich ziemlich eilig damit zu haben, sich noch ein paar Bissen des Essens einzuverleiben und sich dann vor der Tür zum Hof zu versammeln. Nur der erst jetzt wieder zu den anderen hinzugestoßene Jamiro zögert und blickt Bastian skeptisch an.
„Ist es das richtige, was wir tun? Sollten wir nicht besser der Welt ihren natürlichen Lauf lassen?“
„Nun...“, entgegnet Bastian. „Wenn du mir verrätst, was der natürliche Lauf ist, gerne.“
„Die Sache ist doch klar, Jamiro: Entweder, wir bestimmen den Lauf der Dinge, oder wir lassen ihn von anderen Menschen bestimmen.“, mischt sich jetzt auch ein etwas älterer Typ mit Dreitagebart in das Gespräch ein.
„Doch dadurch wird er ganz sicher nicht natürlicher oder unnatürlicher.“
„Vielleicht aber unbequemer...“, meint Bastian, und steckt Jamiro einen silbernen Schlüssel zu.
„Am Besten, du bleibst hier und hältst die Stellung, bis wir zurück sind. Glaub mir, wir müssen es tun, sonst wird die Verfolgung von Andersdenkenden in diesem Land immer schlimmer werden.“
Jamiro zuckt gleichgültig mit den Schultern.
„Von mir aus, tun wir’s eben. Aber ich werde nicht tatenlos rumstehen und euch alleine dort hingehen lassen, nur damit das klar ist! Wenn es eine Falle sein sollte, werdet ihr meine Unterstützung dringend nötig haben.“
„Irgendjemand von uns muss aber hierbleiben.“, unterbricht ihn Bastian und schaut dabei unauffällig in meine Richtung.
„Allein schon wegen unserem Gast. Außerdem will ich Utopia nicht nur von unseren Kleinen bewacht wissen. Ist besser, wenn im Ernstfall auch noch jemand mit etwas Erfahrung hier ist.“
Zögernd greift der bisher im Hintergrund gebliebene Saphire in Jamiros Hosentasche und nimmt den kleinen Schlüssel an sich.
„Ich werde hierbleiben!“, verkündet er entschlossen.
„Mit meinem kaputten Arm würde ich im Einsatz ohnehin keine große Hilfe für euch sein können. Außerdem hab ich ehrlich gesagt auch etwas Schiss vor den vielen Bullen dort...“
„Gut, dann bleibst eben du hier, Saph.“, entgegnet Bastian und nickt bestätigend mit dem Kopf, bevor er sich endlich wieder mir zuwendet.
„Tut mir leid, dass ich dich hier so einfach sitzen lassen muss... aber unser Vorhaben lässt sich leider nicht aufschieben. Es muss unbedingt morgen über die Bühne gehen, sonst haben wir vielleicht nie wieder eine Chance dazu.“
Das Ganze kommt mir zunehmend mysteriös vor. Nicht, dass ich ein grundsätzliches Problem mit Terroristen und Staatsfeinden hätte... dafür ist mir der Staat viel zu gleichgültig. Aber wenn ich mich mitten in deren Hauptquartier befand, dann wollte ich es doch wenigstens wissen... anstatt wie ein dummer Narr mit dem schönen Märchen der friedliebenden Bewohner von Utopia vertröstet zu werden.
„Seid ihr die antifaschistische Brigade?“, platzt es schließlich aus mir heraus, noch bevor der Bastian dazukommt, den Saal zu verlassen. Man hört momentan schließlich jede Menge von dieser ominösen Gruppierung, so dass es mir irgendwie naheliegend erscheint.
Der Alte bleibt stehen und wirft mir einen stechenden Blick zu.
„Wir haben zumindest im selben Blut gebadet.“, murmelt er nachdenklich.
Dann verschwindet er mit seinem Gefolge hinter der Tür, ohne weiter auf mich und meinen fragenden Gesichtsausdruck einzugehen. Nur Jamiro bleibt beim Hinausgehen noch kurz stehen, um mir ironisch zuzuzwinkern.
„Was bedeutete das jetzt?“, frage ich zu Saphire gewandt... in der Hoffnung, dass wenigstens der in der Stimmung ist, es mir zu erklären.
„Das bedeutet: Du wirst es verstehen... irgendwann.“
Ich blicke den anderen skeptisch hinterher.
„Das habe ich doch schon einmal gehört...“
Wenig später, als es ziemlich ruhig in dem Gebäude geworden ist, führt mich der junge Saphire durch die dunklen Gänge. Er zeigt mir ein paar Zimmer der Bewohner... spärlich eingerichtet, mit Matratzen, ein paar Regalen und bunt bemalten Wänden. Nicht gerade gutbürgerlich, aber irgendwie angenehm anders.
„Das hier ist meine Bude!“, meint er schließlich, und deutet stolz auf einen großen Raum, der beinahe vollständig von Graffitis umschlossen ist. Erinnert mich irgendwie an das Jugendhaus, in das mich Little John einmal mitgenommen hatte, nur mit etwas mehr Stil.
In der Mitte liegen zwei bequem aussehende, mit Kissen bedeckte Bettlaken, neben denen zwei betriebsbereite Plattenspieler stehen. Ein wenig weiter davon entfernt hängt ein großer, blauer Sandsack.
„Der gehört Jamiro.“, erklärt mir Saphire, als er meinen neugierigen Blick bemerkt. „Jamiro pennt meistens hier bei mir, auch wenn er noch ein eigenes Zimmer am Ende des Ganges hat.“
Wir gehen weiter. Vorbei an einer Art Sporthalle, in der ein paar halbwüchsige Jungs damit beschäftigt sind, Bälle auf eine Torwand zu schießen...
Ich bleibe stehen, und schaue Saphire fragend in die Augen.
„Was sagt eigentlich das Jugendamt dazu, dass ihr hier den Nachwuchs für euren terroristischen Verein ausbildet?“
Offensichtlich war das die falsche Frage... denn mein Gegenüber drückt mich urplötzlich an die Wand und presst brutal seinen Gipsarm gegen meinen Hals.
„Wir sind keine Terroristen, du blöder Idiot!“, giftet er mich wütend an. „Bastian und die anderen riskieren morgen vielmehr ihr Leben, um das Schlimmste zu verhindern! Für Leute wie dich, die von gar nichts auch nur das Geringste verstehen, aber glauben, über alles bestens Bescheid zu wissen. Und diese Kinder... die sind hier, weil sich das Jugendamt einen Scheiß darum kümmert, ob sie zu hause unterdrückt und geschlagen werden oder nicht.“
Er lässt mich wieder los. An der Röte in seinem Gesicht kann ich ablesen, dass ihm mein Kommentar ziemlich nahe gegangen sein musste.
„Tut mir leid“, antworte ich zögernd. „Aber ihr entführt fremde Menschen, ihr redet von Bomben und Anschlägen... und ihr haust in irgendeinem verlassenen Industriekomplex. Was glaubst du wohl, wie das auf einen Außenstehenden wirken muss?“
„Schwer zu sagen. Auf mich hat es damals einfach nur cool gewirkt...“, erklärt mir Saphire wieder etwas gefasster, bevor wir langsam weiterlaufen.
„Du musst wissen, ich bin mehr oder weniger auf der Straße aufgewachsen. Mein Vater war ein Säufer, meine Mutter hatte ständig irgendwelche Männerbekanntschaften. Ich hing die meiste Zeit mit älteren Typen aus der Nachbarschaft rum... vertrieb mir die Langeweile mit Skateboardfahren, Drogen und kleinen Diebstählen. Die Schule besuchte ich nur noch ganz sporadisch.“
„Das kenne ich.“, bestätige ich kopfnickend. „Mein Vater ist zwar ziemlich ok, obwohl uns meine Mutter sitzen gelassen hat. Aber was die Schule angeht: dort hab ich es auch nie lange ausgehalten.“
„Schule ist eine Lernfabrik.“, meint Saphire verächtlich. „Ähnlich wie bei einer Legebatterie... Oben wird das Wissen und die Erziehung eingetrichtert, und unten ist ein Förderband, auf das möglichst jeden Tag ein dickes Ei fallen soll. Nur dummerweise ist die ganze Fabrik für normale Bilderbuch-Schüler ausgelegt. Ist einer größer als seine Mitschüler und benötigt mehr Platz, so wird er in dem engen Käfig ersticken...“
„Und ist er zu klein, dann fällt er durch die Gitter hindurch und landet im Biomüll.“, ergänze ich bitter. „Dann wäre ich doch lieber ein Huhn auf einem kleinen, gemütlichen Bauernhof.“
Saphire sieht mich skeptisch an.
„Selbst dort musst du aber deine Eier legen, artgerechte Haltung hin oder her. Und wenn du nicht kannst oder nicht willst, macht man ne leckere Suppe aus dir. Oh nein, Mann... auf diese Form von Gnade kann ich verzichten! Ich will in Freiheit leben, verstehst du... richtig in Freiheit. Und selber bestimmen können, was ich mit meinen Eiern anstelle.“
„Was würdest du sagen, war das Wichtigste, was du jemals in der Schule gelernt hast? Von Lesen, Schreiben und den Grundrechenarten jetzt einmal abgesehen...“, frage ich neugierig.
Er zögert.
„Hey, das ist echt fies, weißt du das? So eine Frage stellt man keinem Skater.“
„Versuch es trotzdem!“
„Na gut... ich glaube, das war, als wir in Religion einen Film über den Aufstand im Warschauer Ghetto gesehen haben. Da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie wenig selbstverständlich die Welt, die ich kenne, eigentlich ist. Wenn man bedenkt, dass es gerade mal 60 Jahre her ist, dass auf deutschem Boden noch millionenfach vergewaltigt, gefoltert und gemordet worden ist, dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl zu MacDonalds. Vor allem hat man dann auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man von der NRU oder anderen konservativen Parteien hört, die die individuellen Freiheiten einschränken wollen. Aber wie gesagt... ich glaube, das war echt das einzige Mal, dass ich mir auf dem Nachhauseweg noch Gedanken über etwas gemacht habe, was mir in der Schule erzählt worden war.“
„Bist du deshalb zu Bastian und seiner Gruppe dazugestoßen?“, hake ich interessiert nach.
Aber Saphire schüttelt bedächtig den Kopf.
„Nein, Mann... nein. So einfach war es nicht. Naja, ich hab es mir zugegebenermaßen selber auch nicht gerade leicht gemacht. Aber was soll man denn tun, wenn einen alles ankotzt und kein Ausweg in Sicht ist?
Ich gebe zu, ich hab ein paar Mal mächtig Scheiße gebaut. Zusammen mit meinen damaligen Freunden eine Scheune abgefackelt, Automaten geknackt, sogar ein Auto geklaut... dann haben sie uns gecasht. Als zum wiederholten Mal die Polizei vor der Tür stand, hatten meine Eltern genug. Sie vereinbarten mit dem Jugendamt, mich in ein Heim für schwererziehbare Kinder abzuschieben.
Ha! Die hatten doch gar nie wirklich versucht, mich zu erziehen... wie konnten sie dann überhaupt wissen, ob ich schwererziehbar war?
Dort wurde jedenfalls alles nur noch schlimmer. Mitbewohner, deren asoziales Verhalten sich gegenseitig zu multiplizieren schien. Pädagogen, die einen nie wirklich an sich ranließen. Sie behandelten die Insassen zwar mit Respekt... aber mit dem Respekt, mit dem man ein wildes Tier behandelte. Nicht wie einen gleichwertigen Menschen, sondern immer mit der drohenden Peitsche im Rücken.
Verdammt, wie soll man in so einer Umgebung resozialisiert werden?
Sie können einen füttern, damit man nicht mehr durch die Gitter des Käfigs fällt. Oder einem so lange auf den Schädel hauen, bis man hineinpasst, falls man zu groß sein sollte. Aber wenn es die Käfighaltung an sich ist, die dir nicht gefällt... dann findest du dort nur noch mehr Gründe, um zu kotzen!“
„Bist du ausgebüchst?“
„Ja.“, antwortet Saphire. „Ich hab mich durch ein Fenster abgeseilt. Dann bin ich ziemlich lang durch die Wildnis gelaufen, bis ich schließlich vor einer verlassen aussehenden Industrieanlage stand. Eigentlich wollte ich mich dort ja nur ein wenig aufs Ohr hauen und sehen, ob ich vielleicht noch etwas Wertvolles abstauben konnte. Aber es kam alles ganz anders.
Ich irrte also so durch die Gänge, als mir auf einmal aus einer Tür heraus eine Gestalt entgegentrat.
„Kommst du mit, Essen?“
Es war Jamiro, der damals noch nicht so gut deutsch konnte wie heute.
Ich starrte ihn verwundert an. Ich meine, das war so ziemlich die letzte Frage, die ein normaler Mensch einem ertapptem Einbrecher stellen würde.
Irgendwie konnte ich gar nicht anders, als dem fremden Jungen hinterherzugehen. Auch, weil ich zugegebenermaßen wirklich Kohldampf hatte.
Ich folgte ihm also durch ein paar dunkle Gänge, bis ich schließlich in einem hell erleuchteten Raum stand... in der Mitte eine reichgedeckte Tafel, vor der sich schon ein paar Leute versammelt hatten.
Einer davon war Bastian. Er stand auf und warf einen prüfenden Blick auf mich.
„Entschuldige den Zustand unseres Speisesaals.“, meinte er schließlich, nachdem ich mich ein wenig umgesehen hatte. „Aber wir haben nicht besonders oft Gäste hier.“
Gäste? Ich verstand nicht. Ich war ein Dieb, und war es mein ganzes Leben lang gewohnt gewesen, auch wie ein Dieb behandelt zu werden.
Während ich gierig meine Mahlzeit verschlang, redeten die anderen über Themen, von denen ich nicht besonders viel verstand. Ich achtete auch nicht weiter drauf... Das einzige, was mir bewusst auffiel, war, dass die Älteren mit den Jüngeren auf die selbe Art sprachen wie mit ihren Altersgenossen. Da war kein von-oben-herab-Gehabe zu erkennen, wie ich es von zu Hause oder meinen Kumpels gewohnt war.
Irgendwie war es so ähnlich, wie ich mir wohl eine Familie vorgestellt hätte, wenn ich selber nie von einer enttäuscht worden wäre.
Als ich fertig war, stand ich auf und wollte gehen.
Doch der alte Bastian hielt mich zurück.
„Du bist doch nicht wegen dem guten Essen hier her gekommen...“, meinte er freundlich, und zog einen ledernen Geldbeutel aus seiner Hosentasche.
„Also, wieviel willst du?“
Ich starrte ungläubig auf die Scheine, die mit Bastian entgegenstreckte.
„Vielleicht... hundert?“, flüsterte ich kleinlaut, denn die Situation gefiel mir ehrlich gesagt nicht besonders. Zu stehlen war eine Sache... aber ein Geschenk anzunehmen und dem großzügigen Mitmenschen dabei in die Augen schauen zu müssen, etwas ganz anderes. Etwas, das mir ziemliches Unbehagen bereitete.
Bastian steckte mir einen Hunderter zu, und legte nach kurzem Überlegen noch einmal hundert drauf.
„Was wirst du mit dem Geld machen?“, fragte er.
„Ich kaufe mir ein neues Board!“, antwortete ich. „Zum Skaten, verstehen sie?“
Der Alte nickte einsichtig.
„Und dann?“
„Dann... werde ich skaten, bis die Polizei kommt und mich wieder einsperrt.“
Er nickte erneut.
„Und dann?“
Ich überlegte. Ja, was dann?
Wieder endlose Tage lang meinen Kopf gegen die Wand schlagen, Stress mit meinen Zimmergenossen haben und nie zu Ende gebrachte Mordpläne gegen die Erzieher schmieden.
„Dann geht das Ganze wieder von vorne los.“, entgegnete ich frustriert. „Oder ich wandere diesmal gleich in den Jugendknast… was wohl wahrscheinlicher ist...“
Bastian schien nachzudenken.
„Im Knast kannst du nicht skaten, oder?“
„Natürlich nicht...“, antwortete ich. „Was soll denn die blöde Fragerei?“
„Hmm...“, überlegte Bastian. „Es scheint dir wohl doch nicht so wichtig zu sein... das Skaten, meine ich.“
„Doch, Mann. Es ist für mich verdammt wichtig! Eines Tages werde ich der Größte aller Skater sein... und dann werde ich dieser Welt meinen Stempel aufdrücken und allen zeigen, was ich wirklich wert bin.“
Bastian lächelte.
„Ja, ich glaube, das wirst du.“
„Blödsinn!“, entgegnete ich. „Das werde ich selbstverständlich nicht. Ich verschwende nur gern meine Zeit mit Träumen.“
„Verschwendet ist nur die Zeit, in der du nicht träumst.“, meinte Bastian und sah mir mit einem Mal streng in die Augen. „Du bist vermutlich auch nicht wegen der Zeit, in der du geträumt hast, im Gefängnis gelandet. Sondern wegen den Momenten, in denen du andere für dich träumen ließt.“
Ich hatte keinen Plan, was mir der alte Mann damit sagen wollte, und verabschiedete mich deprimiert von ihm und den anderen.
„Bei uns ist besser als in Knast.“, rief mir Jamiro noch hinterher, als ich schon fast aus der Türe draußen war. Und damit hatte er wohl unweigerlich Recht gehabt.“
„Also bist du geblieben?“, frage ich gedankenversunken.
Saphire schüttelt den Kopf.
„Nein, ich bin gegangen. Aber ich kam wieder zurück, als ich erkannte, dass ich nicht mehr so frei und unbeschwert skaten konnte wie früher. Immer musste ich mich umsehen, weil ich darauf wartete, wieder eingefangen zu werden. Verstehst du? Ich sah keine Treppen mehr, keine Jumps, und keine Wände, an die ich mein Tag sprayen konnte. Alles, was ich erblickte, war die Bühne, auf der in Kürze meine Verhaftung stattfinden würde. Shit... wie soll man da noch Spaß haben?
Also krallte ich mein neues Board untern Arm und rannte, bis ich schließlich wieder hier war.
Tja, und so wurde ich Saphire Rage und drückte der Welt meinen Stempel auf.“
Ich grinse amüsiert.
„Wieso dieser Name?“, frage ich. „Hat das eine bestimmte Bedeutung?“
„Natürlich.“, antwortet Saphire. „Ich denke, jeder Mensch sollte einen Namen wählen, der zu ihm passt. Vor- und Familienname, das ist mir viel zu unpersönlich. Es beschreibt dich nicht wirklich.
Paul Maier... das könnte ein strebsamer Musterschüler sein, genauso wie ein biederer Frührentner, ein sexgeiler Macho oder ein reicher Industrieller.
Aber Saphire Rage... so heißt kein Musterschüler. Nur ein wütender Junge mit funkelnden grünen Augen kann so heißen. Und deshalb trage ich diesen Namen und keinen anderen!“
„Ist das eine der Regeln von Utopia?“, hake ich fragend nach. „Dass man sich einen Namen sucht, der zu einem passt?“
„Utopia hat keine Regeln.“, entgegnet Saphire nachdenklich. „Utopia wäscht dir nur den Kopf, nicht das Gehirn.“
„Aber es verändert die Menschen... so ist es doch, oder?“
Saphire zögert mit der Antwort.
Er scheint irgendetwas zu suchen. Jedenfalls kramt er auffällig lange in seiner Hosentasche herum... dann zieht er ein zusammengefaltetes Blatt Papier hervor und hält es mir auffordernd vors Gesicht.
„Hier... diese Worte hat Benja damals von Cäsar mit auf den Weg bekommen. Ich denke, das beschreibt ziemlich gut, was Utopia ist, und was es mit dir anstellt.“
Er blickt mir gespannt in die Augen, dann beginnt er andächtig vorzulesen.
„Wenn dein Zuhause ein Ort ist, an dem du dich unwohl fühlst... wo dir ständig die Decke auf den Kopf zu fallen und dich zu ersticken droht... und wo Menschen, die dir nicht einmal sympathisch sind, Dinge von dir verlangen, die du nicht tun willst... dann ist es höchste Zeit, dass du erkennst, dass du noch gar nicht zuhause sein kannst.
Lass die Enge hinter dir, sobald du die Kraft dazu hast. Wenn nicht physisch, dann wenigstens geistig. Und dann... dann stell dich auf die Straße des Lebens, häng dir ein großes Schild um, auf dem „Utopia“ geschrieben steht, und suche nach jemandem, der dich mitnimmt.
Irgendwann wird ein Mensch kommen und dich entführen. Ein Träumer vielleicht, ein Suchender, oder einer, der bereits dort war. Du wirst eine Welt betreten, die dich entfesselt und von allem befreit, was andere gegen deinen Willen auf deinen Schultern abgeladen haben.
Mit einem Mal siehst du, wie viel deine Träume wert sind... wie viel sie eigentlich die ganze Zeit über wert waren. Du wirst erkennen, dass dein wahres Zuhause deine Gedanken sind, und dass ein Ort für dich nur dann zur Heimat werden kann, wenn du dich dort auch wohlfühlst.
Wenn du dann eines Tages in deine Welt zurückkehrst, wird sich an der bedrückenden Enge dort nichts geändert haben. Doch die einstmals dicken Betonmauern, die dir so oft das Gefühl gaben, ein Gefangener zu sein, werden dir nurmehr wie hauchdünnes Papier erscheinen.
Du wirst sie einreißen, wann immer sie dir im Weg sind, und dich fortan durch nichts und niemanden mehr am Leben deines Traums hindern lassen. Denn du warst an dem Ort, vor dem sich jeder obrigkeitshörige Spießer mehr fürchtet als vor allen Feuern der Hölle. Du warst in Utopia.“
„Das klingt gut!“, erwidere ich beeindruckt.
Allmählich wird mir klar, was für eine Ungeheuerlichkeit es in der damaligen Zeit gewesen sein musste, so zu denken und zu handeln. Das war mehr als nur mutig... es war schlicht und ergreifend tollkühn.
Ich denke, das ist genau das, was ich auch an der Geschichte von Robin Hood und seinen Mannen bewundere. Menschen, die lieber rebellieren oder ins Exil gehen, als sich in ihrer Heimat unterdrücken und versklaven zu lassen... Menschen, die zu viel Stolz und Ehre besitzen, um sich von anderen herumkommandieren zu lassen. Es gibt sie wirklich! Und ich stehe mitten unter ihnen, genieße ihre Gastfreundschaft und kann die Gefühle, die mich dabei überkommen, nur schwer in geeignete Worte fassen.
Es scheint mir, als würde auf einmal der heilige Gral vor mir stehen. Ich betrachte ihn prüfend von allen Seiten... frage mich, ob er tatsächlich das Blut eines so legendären Revoluzzers wie Jesus Christus in sich trägt, oder ob es sich nur um den beschissene Pisstopf eines notorisch Zukurzgekommenen handelt, dessen Heiligkeit sich auf den Glanz des Messings an seinen Rändern beschränkt.
Am Ende unseres Rundgangs lädt mich Saphire ein, an Jamiros Stelle in seinem Zimmer zu übernachten. Das Essen liegt mir immer noch ziemlich schwer im Magen, und so lasse ich mich gemütlich auf einer der Matratzen fallen.
„Sag mal, Saph... diese Geschichte, von Bastian und dem Zirkus. Du kennst sie doch sicher auch, hab ich Recht?“, frage ich neugierig.
„Klar!“, kommt es prompt als Antwort zurück. „Was immer ich auch in meinem Leben schon mitgemacht haben mag... das ist nicht mal halb so krass wie das, was Bastian und Benja widerfahren ist. Soviel steht fest.“
„Könntest du sie mir vielleicht zu Ende erzählen? Ich meine, weil ich unbedingt wissen möchte, wie das Ganze weiterging...“
Saphire sieht mich ernst an.
„Ich weiß nicht, ob du das wirklich wissen möchtest. Jetzt kommt nämlich der hässliche Teil. Aber gut, ich glaube, den erzählt Bastian ohnehin nicht so gerne...“
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 8 - Der hässliche Teil.
„Bastian wurde an einen kleinen provisorischen Kommandostand geführt. Unterwegs fielen ihm ein paar Soldaten auf, die gerade dabei waren, die Reste der Zelte mit dem Inhalt von einigen Benzinkanistern zu übergießen.
Neben einem großen Lastwagen stand ein Offizier... offensichtlich der Befehlshabende hier.
Er musterte Bastian von oben bis unten.
„Wen haben wir denn da? Du siehst ja ziemlich normal aus für einen Zigeuner!“
„Ich bin kein Zigeuner!“, schrie Bastian ängstlich. „Ich bin Hitlerjunge. Ich... war nur neugierig und wollte sehen, was hier vor sich geht.“
Er griff in die Tasche, um seine Ausweispapiere vorzuzeigen.
Skeptisch nahm ihm der Offizier den Pass aus der Hand und reichte ihn an einen seiner untergebenen Soldaten weiter.
„Wir werden das prüfen, Bastian... Und wenn du uns belogen hast, dann Gnade dir der Führer!“
„Ich habe nicht gelogen...“
Wieder waren mehrere Schüsse zu hören, die Bastian erschrocken zusammenzucken ließen. Währenddessen blieben die Soldaten völlig steif und ungerührt.
„Warum erschrickst du denn, Bastian?“, fragte der Offizier in einem spöttischen Tonfall.
„Du bist doch einer von uns, hab ich Recht? Dann solltest du dich besser fürchten, wenn du mal irgendwann keine Schüsse mehr hörst.“
Bastians Faust ballte sich zusammen... wie gerne wollte sie jetzt in das Gesicht dieses selbstgefälligen Widerlings schlagen.
Nein, er gehörte nicht zu diesen Leuten, die gerade dabei waren, seine neugewonnenen Freunde zu erschießen. Er wollte viel lieber ihr schlimmster Feind sein!
Zwei Soldaten zerrten unter lautem Geschrei einen offensichtlich Verwundeten herbei, der sich vergeblich gegen die brutalen und großen Typen zu wehren versuchte.
„Die Büsche scheinen ja heute voll von diesem Pack zu sein!“, lachte einer, und stieß den Mann vor Bastian und dem Offizier auf den Boden.
Es war Otto, der Posaunenspieler.
Hilfesuchend richteten sich seine Augen auf Bastian, der machtlos mit ansehen musste, wie sie dem Gefangenen einen Schlag mit dem Gewehrkolben verpassten.
„Was ist... Kennst du diesen Mann?“, fragte der Offizier und warf Bastian einen drohenden Blick zu.
„Nein...“, stammelte Bastian. „Nein, ich... kenne ihn nicht...“
Der Offizier griff in seine Jacke, und holte einen kleinen Revolver heraus, den er Bastian mit ernster Miene überreichte.
„Dann will ich dir verraten, wer das ist. Es ist ein Kommunist... ein Feind des gesamten deutschen Volkes. Töte ihn!“
Bastian sah den Offizier geschockt an. Das konnte doch nicht dessen Ernst sein?
Er wusste, dass er niemals schießen könnte... und falls doch, so würde er die Waffe lieber gegen sich selbst oder einen der Soldaten richten, als auf einen harmlosen Zirkusmusiker.
Zitternd legte er an. Er war noch zu jung zu sterben... aber ebenso war ihm klar, dass er auch zu jung zum Töten sein würde.
„Ich... kann das nicht...“
„Wenn du das nicht kannst,“, erwiderte der Offizier streng, „dann muss ich mich schon fragen, ob du nicht doch nur ein verkleideter Zigeuner ist. Hitlerjungen verstehen etwas von Disziplin und Gehorsam... im Gegensatz zu diesen Untermenschen hier.“
„Basti, da bist du ja endlich! Wir haben dich schon überall gesucht...“
Es war Benja, der von der Straße her auf ihn und die anderen zugelaufen kam.
Als er vor dem Offizier angekommen war, hielt er zackig an und salutierte.
„Heil Hitler, Herr Leutnant! Entschuldigen sie die Störung... aber es geht um meinen Kameraden hier. Er hat sich gestern Abend hemmungslos betrunken und danach unbemerkt von unserem Zeltlager entfernt. Ich soll ihn jetzt zurückbringen, damit er die Feldküche auf Vordermann bringen kann... die muss nämlich dringend mal wieder geschrubbt werden.“
Der Offizier sah ein wenig gereizt zu seinem Untergebenen, der mit Bastians Ausweis in der Hand von dem Lastwagen runtersprang.
„Die Papiere sind in Ordnung, Herr Leutnant. Er ist ein Hitlerjunge und wohnt ein paar Kilometer von hier entfernt.“
„Wollen sie auch meine Papiere überprüfen, Herr Leutnant?“, fragte Benja und griff schwungvoll in seine Hosentasche.
„Nein... ich denke, das wird nicht nötig sein.“, entgegnete der Offizier und nahm Bastian wütend die Waffe aus der Hand.
„Aber sag eurem Scharführer, dass seinem Schützling ein paar Schläge mit dem Stock gut tun würden. Wenn er nicht so beschissen jung wäre, dann hätte ich ihn ohne weiteres wegen Befehlsverweigerung hinrichten lassen können!“
Benja schluckte.
„Keine Bange, Herr Leutnant. Wir werden ihm eine angemessene Strafe zu teil werden lassen. Haben wir die Erlaubnis, uns von hier zu entfernen?“
Der Offizier nickte grimmig.
„Verschwindet von hier! Ich weiß schon, warum ich euch führerverdammten Kinder hasse...“
„Heil Hitler!“, schrie Benja pathetisch.
Dann griff er den immer noch völlig sprachlosen Bastian am Arm und zerrte ihn hastig mit sich fort.
Erst langsam gelang es Bastian wieder, einen klaren Gedanken zu fassen.
Er beobachtete die Lastwagen und die Soldaten, die an ihnen vorüberzogen, als sie über die Straße zurück zu ihren Fahrrädern liefen.
„Die wollten mich zwingen, Otto zu erschießen.“, flüsterte Bastian den Tränen nahe.
Wie zur Antwort ertönte aus der Ferne ein einzelner Schuss.
Benja stockte der Atem.
„Ist er jetzt...?“
„Ich muss hier weg!“, keuchte Bastian. „Weg von diesen Mördern.“
Der Rückweg auf der staubigen Waldstraße kam ihnen unglaublich lange vor. Als sie endlich kurz vor den Büschen standen, hinter denen sie ihre Fahrräder versteckt hatten, brauste ein weiterer Lastwagen an ihnen vorbei.
Bastian war sich sicher, hinter der Plane mehrere Kinder gesehen zu haben, die sich ängstlich auf die Ladefläche des Wagens kauerten.
„Seht nur genau hin!“, riss die beiden auf einmal eine laute, von der anderen Straßenseite hertönende Stimme aus ihren Gedanken.
„Die werdet ihr nämlich unter Garantie zum letzten Mal gesehen haben!“
Bastian drehte sich zur Seite und starrte wütend auf den Soldaten, der offensichtlich gerade seine Notdurft verrichtet hatte, und jetzt wieder dienstbeflissen sein am Waldrand abgelegtes Gewehr schulterte.
„Was geschieht denn mit ihnen?“, rief Benja dem Soldaten mit leicht zitternder Stimme zu.
„Wohin bringt man sie?“
Der Soldat blieb auf Höhe von Bastian und Benja stehen und lachte verächtlich.
„Die werden in den Osten umgesiedelt. Das weiß doch jeder!“
Er sah sich um, als ob er sich versichern wollte, keine unerwünschten Zuhörer zu haben.
„Aber wenn ihr mich fragt... weiter als bis Bragowizce kommen die nicht.“
Bastian versuchte, Benja zum Weitergehen zu drängen. Doch der wollte sich die Chance, Genaueres über das weitere Schicksal der Zirkusbewohner zu erfahren, nicht nehmen lassen.
„Wieso? Was ist denn in Bragowizce?“
Zögernd, fast ein wenig scheu, kam der Soldat näher.
„Da ist ein großes Lager, in dem diese Leute das bekommen, was unser Führer für richtig hält.“, flüsterte er hinter vorgehaltener Hand. „So etwas wie eine Mühle, versteht ihr? Egal was man reinkippt... raus kommt am Ende nur noch Mehl.“
Er lachte erneut.
„Man sollte dich da reinkippen!“, giftete ihn Benja wütend an... worauf Bastian seinem Freund entsetzt einen heftigen Stoß in die Rippen verpasste.
„Er meint... wenn einer wie sie in äh, Brakobudze wäre, könnte das ganze sicher noch viel schneller und effizienter erledigt werden.“, verbesserte er hastig.
Der Soldat kratzte sich nachdenklich an der Schläfe.
„Ach, was wisst ihr schon. Zerbrecht euch nicht den Kopf über Dinge, die irgendwo fernab der Heimat geschehen! In der heutigen Zeit ist ein jeder Mensch Soldat. Und ein guter Soldat sollte immer nur den Abschnitt der Front kennen, an dem er gerade zu kämpfen hat. Ein Blick auf die strategischen Karten der Generäle würde ihm ohnehin nur unnötig Angst machen. Genießt den schönen Sommertag, Kinder! Das ist das Beste, was ihr tun könnt, glaubt mir...“
Er nickte Bastian und Benja kaum merkbar zu, dann marschierte er in Richtung seiner Kameraden davon.
Sie radelten ziellos durch den Wald. Kilometer um Kilometer... bis sie schließlich jegliche Orientierung verloren hatten.
Benja hielt als Erster an... worauf es ihm Bastian gleich tat, der ansonsten wohl noch stundenlang so weitergefahren wäre. Dann ließen sich beide erschöpft auf eine Böschung fallen.
An jedem anderen Tag hätten sie sich an den Sonnenstrahlen erfreut, die allmählich durch die Baumwipfel hindurchbrachen und ein warmes, angenehmes Gefühl auf ihrer schweißgetränkten, aber eisig kalten Haut hinterließen. Doch nach allem, was in den letzten Stunden passiert war, waren Bastian und Benja viel zu sehr damit beschäftigt, erst einmal notdürftig ihre wild durcheinanderpurzelnden Gedanken zu ordnen.
„Die... bringen sie alle um!“, platzte es schließlich aus Bastian heraus. „Verdammt, Benja... sag, dass das nur wieder ein beschissener Traum ist. Sag, dass wir jetzt zu den anderen gehen und mit ihnen Spanferkel essen!“
Benja starrte nur schweigend in die grelle Sonne hinauf. Am Liebsten wäre er davon blind geworden... um wenigstens eine gute Entschuldigung dafür zu haben, all seine neugewonnenen Freunde im Stich gelassen zu haben.
Erst, als sich ihm Bastian direkt vors Gesicht stellte und vorsichtig den Schweiß von seiner Stirn abtropfte, wandte er sich beschämt ab.
„Benja... ich weiß, was du jetzt denkst. Aber wir konnten nichts dagegen tun. Sie hätten uns doch nur auch abgeknallt. Und das weißt du genauso gut wie ich!“
Bastian überlegte, was er noch sagen sollte, um seinen Freund aufzumuntern. Er hatte ja wenigstens noch eine Familie, zu der er zurückgehen konnte. Aber Benja? Der würde zu Hause nur windelweich geprügelt werden.
„Hör mal: Wir fahren irgendwo hin. In eine andere Stadt, wo uns keiner kennt... Berlin. Wolltest du dort nicht immer schon mal hin?“
„Verschwinde von hier!“, murmelte Benja auf einmal, und starrte Bastian finster in die Augen. „Lass mich einfach allein.“
Bastian schüttelte ihn wütend an den Schultern.
„Und dann? Was willst du dann machen, häh? Dich vielleicht am nächsten steilen Abhang in den Tod stürzen?“
„Ja, vielleicht.“, antwortete Benja leise. „Aber das ist meine Sache. Denkst du wirklich, unsere Freundschaft ist so was Besonderes, dass du das Recht hast, ständig wie eine Klette an mir dranzuhängen und mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe?“
Er hatte Tränen in den Augen, als er Bastian schließlich grob von sich weg stieß.
„Denkst du das, ja?“
Bastian trat wütend auf sein vor ihm liegendes Fahrrad ein. Dann bückte er sich, um einen großen Stein von dem nicht geteerten Waldweg aufzunehmen. Er betrachtete ihn eine Weile, bevor er ihm Benja mit ziemlicher Wucht ins Gesicht schleuderte.
Benja schrie laut auf, und hielt sich schmerzerfüllt die Hand vor die Nase.
„Spinnst du jetzt total?“, brüllte er, während einige Tropfen warmes Blut über seinen Mund liefen.
Bastian kam langsam näher, und wischte sich selber eine Träne vom Gesicht.
„Du wolltest doch wissen, was ich denke.“, erklärte er traurig. „Was ich über unsere Freundschaft denke...“
Benja sah ihn fragend an.
„Dann wirst du also gehen?“
Bastian schüttelte entschlossen den Kopf.
„Nein! Ich halte unsere Freundschaft nicht nur für so besonders, dass ich das Recht habe, wie eine Klette an dir dranzuhängen... ich halte sie sogar für so besonders, dass ich alles mit dir tun darf, was ich für richtig halte! Genau wie du bei mir. Los, knall mir doch auch einen Stein in die Fresse. Es ist egal. Du kriegst mich nicht mehr von dir los... das hättest du dir überlegen müssen, bevor wir jahrelang jeden einzelnen Tag miteinander verbracht haben. Bevor du mir das Gefühl gegeben hast, dass du genauso zu meinem Leben dazugehörst wie ich selber. Jetzt hast du keine Wahl mehr. Du musst mich schon töten, wenn du jemals wieder alleine sein willst!“
Benja sah mit einem Lächeln auf den Lippen zu seinem Freund auf und wischte sich angestrengt das Blut aus dem Gesicht.
„Du bist völlig krank im Hirn, Basti.“, entgegnete Benja. „Mir hat noch nie jemand aus Freundschaft einen Stein ins Gesicht geworfen.“
Dann umarmten sie sich beide... so fest, als wollten sie sich gegenseitig die Luft abdrücken.
„Du bist der beste Freund, den ich jemals haben werde. Tut mir leid, dass ich dich wirklich wegschicken wollte.“
„Tut mir leid wegen dem Stein.“, konterte Bastian.
Fasziniert beobachtete er, wie das rote Blut auf Benjas schmalen Lippen in der Sonne glänzte. Was geschah bloß mit ihnen?
Mitten im Wald, fernab ihrer Eltern und des ganzen Systems, wirkte auf einmal alles so ungezwungen, so natürlich. Keine mahnenden Worte mehr, keine Reden über die Pflichten eines Volksdeutschen. Nur die Sonne, die Bäume, und dieses seltsame Gefühl im Bauch.
Bastian konnte nicht mehr anders. Er legte sanft seinen Arm um Benjas und gab ihm einen gefühlvollen Kuss auf den Mund.
Benja grinste amüsiert.
„Endlich traust du dich mal was! Ich hab schon geglaubt, du würdest es dir nie eingestehen wollen.“
„Was denn eingestehen?“, fragte Bastian verwirrt.
„Na, dass wir uns längst ineinander verknallt haben.“, sprach Benja das Offensichtliche aus.
„Du weißt doch genauso gut wie ich, wie es dir immer gefallen hat, wenn ich mal mein Hemd ausgezogen habe und mit nacktem Oberkörper vor dir stand. Und sag jetzt nicht, dass ich mir das nur einbilde... Seit wir damals im Zeltlager zum ersten Mal nebeneinander geschlafen haben, weiß ich, dass wir zusammengehören. Und nur, weil man dir die ganze Zeit einredet, dass du als aufrechter Deutscher so etwas nicht fühlen darfst, verleugnest du es.“
Bastian blickte seinem Freund tief in dessen blaue Augen.
„Aber ich bin jetzt kein Deutscher mehr, Benja... Ich bin ein Bürger von Utopia. Da darf man fühlen.“
Sie küssten sich wieder... diesmal jedoch wesentlich wilder und hemmungsloser. Was immer Bastian davor auch für Zweifel gehabt haben mochte... von jenem Moment an wusste er, dass man sich nicht bevormunden lassen durfte. Von niemandem! Und ihm wurde klar, wem er diese Erkenntnis in erster Linie zu verdanken hatte.
„Cäsar hat uns befreit...“, flüsterte er leise in Benjas Ohr. „Cäsar hat uns gezeigt, dass wir uns unsere Freiheit nehmen müssen, wenn keiner bereit ist, sie uns zu geben. Und jetzt... jetzt sitzt er in der Klemme. Vielleicht ist er sogar schon tot. Und wer befreit jetzt ihn?“
Benja löste sich von seinem Freund und blickte ihn mit funkelnden Augen an.
„Wir, Basti. Wir werden ihn befreien!“
„Aber das ist unmöglich! Du siehst doch, die machen kurzen Prozess, wenn ihnen einer in die Quere kommt.“, meinte Bastian frustriert.
„Was ist mit Sarah?“, erwiderte Benja. „Liebst du sie noch?“
„Ich... verdammt, frag mich was Leichteres, Benja.“, seufzte Bastian. „Ich weiß gerade echt nicht mehr, wen ich alles lieben möchte. Das mit Sarah... ach, es ist doch völlig egal. Du hast Recht, wir müssen sie da irgendwie rausholen. Sie und die anderen. Sonst ist Utopia unwiederbringlich verloren...“
„Du hast mir doch versprochen, dass du mit mir in jede Stadt gehst, in die ich möchte. Weißt du... ich wollte mir schon immer mal Bragowizce anschauen.“
„Du weißt doch nicht mal, wo das liegt...“, antwortete Bastian grinsend.
„Doch.“, meinte Benja. „Irgendwo im Osten. Was ist, bist du dabei?“
Bastian nickte.
„Wenn wir es schaffen, das Ding zu finden, dann wird es uns auch irgendwie gelingen, unsere Freunde da rauszuholen. So groß kann ein polnisches Gefängnis ja nicht sein....“
„Hoffen wir’s!“, meinte Benja.
Mit dem Rest von Bastians Ersparnissen, die dieser von zu Hause hatte mitgehen lassen, kauften sie sich eine Fahrkarte nach Berlin. Von dort ging es weiter mit einer kleinen Bummelbahn tief ins heutige Polen hinein.
Dass eine Reise damals noch ein größeres Abenteuer war als heute, versteht sich von selbst. Erst recht, wenn man wie Bastian und Benja noch nie so weit von zu Hause weggewesen war.
Obwohl sich Deutschland im Krieg befand, verlief die Fahrt erstaunlich ruhig. Niemand schien die zwei Hitlerjungen wahrzunehmen... alle waren ganz offensichtlich viel zu sehr mit ihren eigenen Sorgen und Nöten beschäftigt.
Lediglich einmal wurden die beiden aus ihren Gedanken gerissen... als sich nämlich urplötzlich ein alter, fettleibiger Kontrolleur vor ihnen aufbaute und sie mit grimmiger Stimme fragte, wo sie denn so alleine hin wollten.
„Wir wollen an die Front.“, erklärte ihm Benja. „Wir melden uns freiwillig, um für unser Vaterland zu kämpfen!“
Der Kontrolleur musterte Benja von oben bis unten.
„Na, dann haben wir den Krieg ja schon so gut wie gewonnen.“, murmelte er, bevor er kopfschüttelnd weiterging.
„Meinst du, der hat es geschluckt?“, fragte Bastian.
Benja nickte stolz.
„Na klar. Du weißt doch, mir glauben sie alles...“
„Ein Hoch auf den jugendlichen Idealismus!“, hörten sie auf einmal eine spöttische Stimme von der hinter ihnen befindlichen Sitzgruppe herklingen.
Überrascht sahen sie auf, und erblickten einen dürren, bärtigen Mann, der sich langsam eine Zigarette anzündete und zu den beiden hinüberschaute. Mit seiner Nickelbrille und den zarten Händen machte er einen eher harmlosen Eindruck.
„Wir tun, was wir tun müssen.“, versuchte sich Bastian zu rechtfertigen.
„Blödsinn!“, erwiderte der Fremde erregt. „Ihr müsstet in diesen schweren Zeiten bei euren Familien bleiben und eure Mütter trösten. Stattdessen könnt ihr es gar nicht abwarten, euch an der Ostfront zusammenschießen zu lassen. Wirklich, sehr nobel von euch. Nur leider unendlich dumm, wie so vieles hier.“
„Reden sie nicht so!“, herrschte ihn Benja an. „Sie wissen nichts über uns. Wir könnten genauso gut schwul sein und nur als Tarnung die Hitlerjungen spielen. Vielleicht versuchen wir ja in Wahrheit, eine jüdische Kommunistin aus dem Gefängnis von Bragowizce zu befreien.“
Der Fremde hustete, als ob er sich verschluckt hätte. Dann drückte er seine Zigarette hastig auf dem Boden des Abteils aus, griff seine Aktentasche und zwängte sich auf die Bastian und Benja direkt gegenüberliegende Bank.
„So dummdreist wie ihr ausschaut, glaube ich euch das aufs Wort!“, flüsterte er erregt. „Jetzt hört mal her: Ich will gar nicht weiter wissen, wieso ihr das für eine gute Idee haltet. Verschwindet einfach von hier, so schnell ihr könnt. Den Menschen in Bragowizce kann keiner mehr helfen...“
„Vielleicht hat es einfach bloß noch niemand versucht.“, erwiderte Benja verärgert.
Der Fremde lächelte bitter.
„Ohje, ihr armen Kinder. Ihr habt wirklich keine Ahnung, auf was ihr euch da einlasst. Ich sollte euch knebeln, fesseln und mit nach England nehmen, damit ihr keine Dummheiten anstellen könnt! Aber ich kann kein Risiko eingehen. Nicht jetzt.“
Er griff in seine Aktentasche und nahm einen kleinen schwarzen Revolver heraus, den er Bastian unauffällig in den Schoß legte.
„Hier. Benutzt ihn, wenn es nicht mehr anders geht. Aber bitte hört auf mich und lasst es nicht so weit kommen, ok?“
„Ok? Was sind sie... ein Spion oder so was?“, fragte Benja fasziniert.
Schlagartig wurde der Fremde ernst, und verpasste Benja eine schallende Ohrfeige. Dann richtete er drohend seinen Zeigefinger auf Bastian.
„Vertraut niemandem mehr in diesem Land, hört ihr? Haltet euren Mund... sagt in Zukunft zu keinem Kind, keinem Alten, keinem noch so harmlos aussehenden Reisenden auch nur ein Sterbenswörtchen über das, was ihr vorhabt. Oder ihr endet mit einer Kugel im Kopf!“
Mit diesen Worten erhob sich der Fremde und verließ verärgert das Abteil, ohne sich noch ein weiteres Mal nach den beiden erschrocken dreinblickenden Freunden umzusehen.
Nachdem er schließlich laut die Türe zugeknallt hatte, versteckte Bastian hastig die Waffe in seinem Hosenbund.
„Lass dich nicht entmutigen!“, flüsterte Benja und griff vorsichtig nach Bastians Hand . „Wir kriegen das schon irgendwie hin. Außerdem... das Glück ist immer auf der Seite der Gerechten.“
„Wer sagt das?“, antwortete Bastian wenig überzeugt.
Benja sah seinem Freund eindringlich in die Augen.
„Ich sage das, Basti! Weil ich einfach fühle, dass es heute Abend so sein wird.“
„Wenn nicht, dann hab ich wieder was gut bei dir, oder?“, scherzte Bastian.
„Klar.“, antwortete Benja. „Dann darfst du dich auf meine Schultern hocken und ausruhen, während wir vor der SS davonrennen.“
An der Endstation machten sie sich zu Fuß auf den Weg. Schon bald gabelte sie ein polnischer Bauer auf, der sie auf seinem großen Heuwagen bis fast vor die Tore der kleinen Stadt Bragowizce brachte.
Der Bauer schien ein freundlicher, mitteilungsbedürftiger Zeitgenosse zu sein, denn er erzählte bereitwillig in gebrochenem Deutsch von seiner schönen Heimat. Auf die Frage nach dem Lager wurde er jedoch schlagartig ernst und deutete nur stumm auf einen dunklen Wald.
Bastian und Benja nickten ihm zu und sprangen aufgeregt vom Wagen herunter. Bald würden sie der ganzen Welt zeigen, dass es ein Fehler war, sich mit den Bewohnern von Utopia anzulegen.
„Denk an das, was mir Cäsar erzählt hat!“, riet Benja, um seinem Freund etwas Mut zuzusprechen.
„Wir waren an einem Ort, vor dem sich diese Nazis fürchten wie vor nichts anderem. Ein Ort, an dem Menschlichkeit und Nachsicht herrschen. Dagegen kommen die nicht an!“
„Also, was schlägst du vor?“, fragte Bastian zögernd.
„Das ist doch ganz klar...“, erwiderte Benja überzeugt. „Wir gehen rein, holen sie raus und flüchten in den Wald. Ganz so, wie wir es mal in diesem einen Seeräuberfilm gesehen haben, weißt du noch? Und dann... dann drehen wir diesem Scheißland für immer den Rücken zu!“
Kapitel 9 - Das Lager
Benja stand mit bleichem Gesicht am Waldrand und starrte unentwegt in die selbe Richtung. Bastians Lippen zitterten... unter Schock stehend brachte er keine Worte mehr heraus, nur ein leichtes Weinen war zu hören. Verzweifelt hielt er sich die Hände vors Gesicht und sank vor den Füßen seines Freundes zu Boden.
Was folgte, war minutenlanges Schweigen.
Sie waren auf eine kleine Hütte mit ein paar Zelten vorbereitet gewesen... auf ein paar patrouillierende Wachen... auf vielleicht dreißig oder vierzig Gefangene.
Doch was sie auf der unter ihnen liegenden Lichtung sahen, hatte eine völlig andere Dimension.
Hunderte Meter massive Mauern, Wachtürme mit Maschinengewehrstellungen, Stacheldraht. Statt einem Haus waren es neunzehn riesige Baracken, eine große Halle und etliche Nebengebäude. Die Wachen patrouillierten in Zehnergruppen... und rings um die Begrenzungen herum herrschte ein ständiges Kommen und Gehen von Lastwägen, Militärfahrzeugen und nicht enden wollenden Gefangenenkolonnen.
„Wir gehen rein, holen sie raus und flüchten in den Wald.“, flüsterte Benja apathisch.
„Wir gehen rein, holen sie raus, und flüchten in den Wald.“
Bastian fühlte einen starken Brechreiz. Er beugte sich nach vorne, um sich zu übergeben... doch außer einem trockenen Husten und etwas Spucke brachte er nichts heraus.
„Wir gehen rein, holen sie raus, und flüchten in den Wald.“
Bastian stand auf. Er taumelte... musste sich schließlich an einem nahen Baum abstützen, um nicht wieder kraftlos zu Boden zu sacken.
„Das ist... eine ganze Gefängnis-Stadt!“, meinte er, von seinen Gefühlen noch immer sichtlich überwältigt. „Wie können Menschen nur so etwas bauen? Verdammt... was geht in deren Köpfen vor? Wie kann ein Mensch... nein, könntest du dir vorstellen, so etwas Krankes aufzubauen?“
Benja wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Das ist er...“, murmelte er leise. „Der neunköpfige Drache, von dem ich dir erzählt habe. Weißt du noch?“
Bastian schüttelte kraftlos den Kopf.
„Benja, nein... hör auf damit! Lass uns von hier fortgehen. Wir werden unsere Freunde niemals wiedersehen. Wahrscheinlich sind sie längst tot.“
Deprimiert senkte Benja den Kopf. Er wollte sich einfach nicht damit abfinden, dass sie hier nichts mehr tun konnten.
Gegen Abend zog ein Gewitter auf.
Bastian und Benja hatten unter dem Vordach einer kleinen, verlassenen Waldhütte Zuflucht gefunden. Der warme Regen prasselte unablässlich auf das morsche Holz über ihnen, und gelegentlich drang ein dicker Tropfen hindurch und traf einen der beiden Freunde im Gesicht.
Bastian hatte sich ganz eng zusammengerollt... ihm war kalt, obwohl ihm Benja versicherte, dass sich seine Stirn glühend heiß anfühlte.
„Du hast starkes Fieber.“, hörte er seinen Freund sagen. Aber er konnte ihn nicht sehen. Er sah nur helle Schemen in der Dämmerung, die wie tanzende Derwische auf und ab zu hüpfen schienen.
„Die Aufregung der letzten Tage war wohl zu viel... Halte durch! Morgen fahren wir zurück nach Hause, Basti! Ich bring dich zu deinen Eltern, und dann sehen wir weiter.“
Jetzt erkannte er Benjas Gesicht... aber nur für einen kurzen Moment. Es zog von links nach rechts an ihm vorbei, und verschwand dann wieder in der Dunkelheit.
Bastian schloss die Augen und wünschte sich, dass er sich einfach auflösen würde... zusammen mit all seinen Problemen, seinem schmerzenden Schädel, und dieser verdammten Gefängnis-Stadt.
Er konnte nicht sagen, ob er wachte oder träumte...
Jedenfalls sah er irgendwann in der Nacht einen Gefangenen durch die Büsche rennen... jung, mit Panik in den Augen, völlig abgemagert.
„Sieh mal, wen wir hier aufgegabelt haben!“, erklang Benjas Stimme aus der Tiefe des Raumes.
„Der wird nicht mehr weit kommen, wenn er rumläuft wie ein Sträfling.“
Bastian sah erst das angsterfüllte Gesicht des Entflohenen... dann dessen grau-weiße Gefängniskleidung. Alles schien in Bewegung zu sein, wie auf einem großen Karussell.
„Wie heißt du?“
Der Gefangene wirkte schwach. Nur mühsam brachte er ein paar Worte heraus.
„Mein Name ist... Georg...“
„Georg, du bist ab jetzt bei der Hitlerjugend. Zieh dir diese Klamotten hier an, und dann versuche, so schnell wie möglich aus dieser Gegend zu verschwinden!“
Bastian hörte das Geräusch von klimpernden Münzen.
„Hier, kauf dir damit was zu Essen.“, meinte Benja.
„Und du? Hast du jetzt nichts mehr zum Anziehen?“
„Doch. Ich habe ja diesen schicken Plunder hier. Das ist die neueste Mode aus Paris, so was wollte ich schon immer mal tragen.“
Benja lachte... aber Bastian war es unmöglich zu lokalisieren, woher das Lachen kam.
„Du bist verrückt. Aber Danke!“, sprach der Gefangene.
Bastian bemühte sich verzweifelt, etwas erkennen zu können. Doch da schien nichts zu sein, außer einer Bretterwand und dem dunklen Himmel, über den einige helle Wolken kreisten. Für einen kurzen Moment glaubte er, einen gewaltigen Blitz gesehen zu haben. Dann war wieder alles still und dunkel.
Bastian schlief ein.
Und er schlief durch bis zum nächsten Morgen... bis ihm ein greller Sonnenstrahl direkt auf die Augen brannte.
Er hielt sich schützend die Hand vors Gesicht. Sein Schädel brummte, als würde eine ganze Panzerdivision in seinem Gehirn Patrouille fahren.
„Mach das verdammte Licht aus, Benja.“, flüsterte er.
„Benja?“
Langsam gewöhnte sich Bastian an die Helligkeit. Er konnte jetzt wieder das kleine Vordach erkennen, unter dem er lag... die alte Decke, die ihm Benja am Vorabend besorgt übergezogen hatte... und die hohen Bäume, die rings um die Hütte herum standen.
Von Benja jedoch war weit und breit nichts zu sehen.
Bastian stand auf. Obwohl er immer noch etwas wackelig auf den Beinen war, fühlte er sich schon wieder um einiges besser als noch ein paar Stunden zuvor.
Er wankte vorsichtig zu dem Rucksack hin, in dem sich Benjas ganzes Hab und Gut befand. Nichts fehlte... bis auf den Revolver, den Bastian nirgends mehr entdecken konnte.
Jetzt erst fiel sein Blick auf einen schwachen Schriftzug, der offensichtlich mit einem Stein oder ähnlichem in das nasse Holz geritzt worden war.
„Ich musste es tun. Bitte verzeih mir, ich liebe dich.“
Bastian blickte hilfesuchend in den hellen Morgenhimmel empor.
Was immer sein Freund vor hatte... Bastian wusste, dass es einfach nur schrecklich dumm sein würde. Und er hatte keine Ahnung, was er jetzt noch tun konnte, um Benja da wieder herauszuhelfen.
„Zählappell. Alle Gefangenen stillgestanden!“
Hunderte Menschen hatten sich vor der Offiziersbaracke des Lagers versammelt. Einige husteten, schwankten... konnten sich nur mit äußerster Mühe auf den Beinen halten.
Zahllose Fliegen schwirrten um sie herum. Mit unbarmherziger Zielstrebigkeit suchten sie sich genau die Gesichter derjenigen Gefangenen als Nistplätze aus, die dem Tod noch ein ganzes Stückchen näher zu sein schienen als der Rest ihrer geplagten, ausgemergelten Leidensgenossen.
„Ich sagte stillgestanden, ihr ungehorsames Pack!“, schrie der grimmig dreinschauende Wachmann zum zweiten Mal. An seiner Seite stand Oswald Gründlich, ein gepflegter Mitdreißiger mit Brille und militärisch-korrektem Kurzhaarschnitt. Er war der stellvertretende Lagerkommandant und beobachtete mit stoischer Mine das quälende Treiben um sich herum.
Gründlich sah keine Menschen, wenn er seinen Blick durch das Lager schweifen ließ, das er für seinen meist anderweitig beschäftigten Vorgesetzten leitete. Er sah nur Wachleute und Gefangene.
Das Lager war für ihn kein Ort des Leidens, kein menschenunwürdiger Schreckensknast... für ihn war es einfach nur ein Betrieb, den es zu managen galt. Die Menschenleben, mit denen er jonglierte, berührten ihn nicht. Hauptsache, am Ende des Tages stimmten die Zahlen und die Statistik.
„Sind wir vollzählig, Strunz?“
Der Wachmann antwortete nicht. Stattdessen begann er eifrig damit, noch ein weiteres Mal die komplette Belegschaft des Gefangenenregiments durchzuzählen.
„Was ist, Strunz? Sind sie taub oder was?“, wiederholte Gründlich gereizt. Daraufhin kam sein Untergebener eilig zu ihm gerannt und salutierte.
„Melde gehorsamst, Herr Kommandant: Alle vollzählig. Bis auf einen...“
Gründlich glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
„Was soll das heißen: Bis auf einen? Sagen sie bloß nicht, dass nach dem gestrigen Missgeschick ihrer Männer schon wieder ein Gefangener flüchten konnte!“
„Nein, das ist es diesmal nicht.“, versuchte sich Obergefreite Strunz zu rechtfertigen.
„Wir haben... so wie es aussieht, haben wir auf einmal einen Gefangenen zu viel im Lager, Herr Vizekommandant.“
Jetzt geriet Gründlich erst richtig in Rage. Er streifte den schwarzen Handschuh von seiner rechten Hand und verpasste seinem Untergebenen damit eine schallende Ohrfeige.
„Das Reich wird eines Tages zu Grunde gehen, Strunz!“, brüllte er aufgebracht und warf den Handschuh vor den Gefangenen in den Staub. „Soldaten, die nicht einmal ausrechnen können, wie viele Gefangene sich in einem solch ordentlich geführtem Lager wie Bragowizce aufhalten, werden eines Tages auch bei strategisch bedeutsameren Aufgaben Fehler begehen, soviel steht fest.
Haben sie eine Ahnung, wie es an der Front in Russland aussieht? Ich sage ihnen, es sieht dort verdammt beschissen aus. Und wissen sie auch, warum?“
Strunz senkte seinen Kopf und zuckte unbedarft mit den Schultern.
„Keine Ahnung, Herr Vizekommandant.“
„Weil zu viele Menschen in unserem Land nicht zählen können!“, schrie Gründlich außer sich vor Zorn. „Sie werden jetzt auf der Stelle den Gefangenen, der ihrer Meinung nach zu viel ist, erschießen!“
Mit diesen Worten drückte er dem eingeschüchterten Obergefreiten auffordernd eine Pistole in die Hand.
Strunz lief mit prüfendem Blick durch die Reihen der Gefangenen.
„Ich habe mich nicht verrechnet...“, fluchte er leise. „Ich habe mich nicht verrechnet.“
„Na machen sie schon, Strunz! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.“
Genervt sah Strunz zu seinem Vorgesetzten hinüber.
„Also gut.“, meinte er, wieder an die Gefangenen gewandt.
„Ich gebe euch dreißig Sekunden Zeit, um mir zu sagen, wer von euch hier zu viel ist. Wenn ich keine klare Antwort bekomme, werden zehn von euch dran glauben müssen!“
Gründlich grinste. Die Show seines Untergebenen schien ihm offensichtlich Freude zu bereiten.
Unterdessen stand Benja mit schweißtriefendem Gesicht in der hintersten Reihe. Es war ihm gelungen, sich unerkannt in eine vor den Toren des Lagers arbeitende Häftlingskolonne einzureihen.
Obwohl er sein Gesicht mit Schlamm und Dreck eingerieben hatte, wirkte er im Vergleich zu den anderen Gefangenen immer noch auffallend gepflegt. Er fragte sich, wie lange es dauern würde, bis man ihn als den Eindringling entlarven würde.
Sicher würden ihn die anderen Gefangenen verraten, um ihr eigenes Leben zu schützen.
Benja schielte nervös zu den rechts und links von ihm stehenden Häftlingen. Doch keiner von denen schien von ihm Notiz genommen zu haben... alle blickten bloß mit sturem Blick nach vorne zu den Wachen.
„Noch zehn Sekunden!“
Benja umklammerte den Griff der Pistole, so fest er konnte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem ihn endlich niemand mehr herumschupsen konnte... jedenfalls nicht, ohne dafür teuer bezahlen zu müssen.
„Ist vielleicht das ihr Mann?“, rief ein vom Tor her kommender Soldat seinem Vorgesetzten zu. Dabei stieß er eifrig den ziemlich mitgenommen aussehenden Bastian vor sich her.
„Den haben wir aufgegabelt, als er draußen um unser Lager herumgeschlichen ist.“
Gründlich veranlasste Strunz mit einer Handbewegung dazu, den Countdown einzustellen. Dann wandte er sich neugierig dem mittlerweile vor ihm auf dem Boden kauernden Bastian zu.
„Das ist doch einer aus der Hitlerjugend!“, meinte er immer noch stark verstimmt. „Kann mir mal irgendeiner von euch Armleuchtern erklären, was ein Kind hier zu suchen hat?“
„Ich bin kein Kind mehr!“, empörte sich Bastian und blickte zornig zu dem uniformierten Befehlshaber auf.
„Zumindest weiß ich, was falsch und was richtig ist. Im Gegensatz zu ihnen...“
Er spuckte auf Gründlichs blankgeputzte Stiefel, worauf er sich einen heftigen Schlag ins Gesicht einfing.
Dann spürte er plötzlich die Pistole von Strunz an seiner pochenden Schläfe.
„Soll ich ihn erschießen, Herr Vizekommandant?“, fragte der Obergefreite seinen empörten Vorgesetzten. „Damit die Zahlen wieder stimmen?“
Gründlich schien zu überlegen.
Nachdenklich ließ er seinen Blick über die immer noch verkrampft strammstehenden Gefangenen schweifen. Irgendetwas schien ihm nicht geheuer zu sein. Doch schließlich hob er seine Hand, um Strunz das Kommando zum Schießen zu geben.
„Was ist hier los, Gründlich?“
Alle Augen richteten sich auf die Offiziersbaracke, an deren Eingang ein etwas kantig wirkender, älterer Mann erschien.
Beinahe würdevoll schritt er die hölzernen Stufen zu dem großen Hof hinab. Dann sah er mit strengem Blick auf Gründlich und Strunz, der immer noch seine Pistole an Bastians Kopf gedrückt hatte.
„Dieses... dieses Kind hier... hat vor dem Lager herumspioniert, Herr Kommandant! Das ist alles... ansonsten ist nichts vorgefallen, was ihr Interesse verdient hätte.“, erklärte Gründlich, der auf einmal wesentlich schüchterner klang als zuvor.
„Wenn sie gestatten, Gründlich: Was mein Interesse verdient hat, entscheide ich immer noch selber.“, erwiderte der Kommandant gereizt.
Jetzt sah Benja seine Chance gekommen.
„Dieses Schwein lügt!“, schrie er, sprang aus seiner Reihe heraus und zeigte mit einer aufgeregten Handbewegung zu Gründlich hinüber.
„Er wollte kaltblütig zehn Gefangene erschießen lassen... und wenn sie nicht gekommen wären, dann hätte er das wohl auch getan!“
Der Kommandant stutzte einen Moment, bevor er Strunz mit einer kurzen Geste befahl, die Waffe von Bastians Kopf herunterzunehmen. Dann blickte er Benja streng in die Augen.
„Falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest: das hier ist kein Kraft-durch-Freude Erlebnislager, Junge! Alles, was Gründlich tut, tut er für gewöhnlich in meinem Auftrag. Jedenfalls hoffe ich das...“
Er warf seinem Stellvertreter einen strengen Blick zu.
„Natürlich, Herr Kommandant.“, schleimte dieser. „Heißt das, ich darf den Hitlerjungen und diesen aufsässigen Gefangenen jetzt erschießen lassen?“
Der Kommandant zögerte. Er starrte unentwegt auf Benjas rechte Hand, die dieser verkrampft in seiner Hose stecken hatte. Dann sah er zu Bastian herüber, der mit seinem Freund intensiven Blickkontakt hatte.
„Warten sie. Die beiden kennen sich doch...“, überlegte er. „Wer ist dieser junge, kräftige Gefangene hier?“
Er deutete auf Benja.
Strunz bemühte sich, eine Erklärung zu finden.
„Das müsste... müsste derjenige sein, der zu viel ist.“, stammelte er, worauf ihn sofort Gründlichs strafender Blick traf.
„Was soll das heißen: Zu viel?“
Der Kommandant ging drohend auf seine Untergebenen zu.
„Das heißt, dass dieser Gefangene offensichtlich... in das Lager eingebrochen ist. So, wie es dieser Hitlerjunge wahrscheinlich auch versucht hat.“, bemühte sich Gründlich, die ungewöhnliche Situation zu beschreiben.
Ein leichtes, anerkennendes Lächeln glitt über die Lippen des Kommandanten.
„Das hört sich doch nach einer interessanten Geschichte an... Finden sie nicht auch, Gründlich? Die beiden Einbrecher sollen sofort in mein Büro kommen! Und wir beide, Gründlich... wir reden später über ihre offensichtliche Inkompetenz, was die Gewährleistung der Sicherheit in diesem Lager angeht.“
Er wandte sich schroff von den anderen ab und marschierte zielstrebig zurück in die Baracke.
„Mein Name ist Oberst Breuninger.“, erklärte der alte Kommandant, nachdem zwei Wachen Bastian und Benja in sein Arbeitszimmer geführt hatten. „Und wenn ihr nicht von Gründlich zu Brei geschlagen werden wollt, dann rate ich euch, mir nicht zu erzählen, dass ihr euch nur rein zufällig hier in unserem schönen Lager verlaufen habt! Also raus mit der Sprache: Erzählt mir eine Geschichte, die mein altes Herz bewegt... und ich werde sehen, was ich für euch tun kann.“
„Haben sie das denn... ein Herz?“, fragte Benja provozierend. „Kann ein Mensch ein Herz haben, der ein solches Kommando innehat wie sie?“
Breuninger seufzte und griff behutsam nach einer Tasse Tee, die griffbereit auf seinem Schreibtisch stand.
„Ich habe einen Sohn... er dürfte ungefähr in eurem Alter sein. Ob ihr das glaubt oder nicht, ich war ihm immer ein guter Vater. Habe mit ihm Fußball gespielt, musiziert, Ausflüge gemacht... Ja, ich kann von mir behaupten: Ich habe ein Herz! Zumindest dann, wenn ich außer Dienst bin.“
Er machte eine kleine Pause, in der er einen großen Schluck aus der Tasse nahm und seinen Blick auf das Porträt Adolf Hitlers richtete, das eingerahmt hinter seinem Schreibtisch hing.
„Aber ich habe auch einen Eid geschworen. Und der lautet, dass ich meinem Führer und dem Ruhm der deutschen Nation dienen werde... auch, wenn sich diese beiden Dinge zunehmend schwerer miteinander in Einklang bringen lassen.“
Benja und Bastian warfen sich einen verschworenen Blick zu. Keiner von beiden wusste, wie sie jetzt am Besten reagieren sollten.
Die Waffe ziehen und den Kommandanten als Geisel nehmen? Oder ihm vertrauen und einfach ihre Geschichte erzählen?
Schließlich beschloss Bastian, es erst einmal mit der Wahrheit zu versuchen.
„Also gut, ich erzähle ihnen, was passiert ist. Aber sie sorgen dafür, dass während dieser Zeit kein Gefangener in diesem Lager erschossen wird!“
Der Oberst nickte den beiden hinter Bastian und Benja stehenden Wachen zu, worauf einer von ihnen salutierte und den Raum verließ.
„Seht das als Geste meines guten Willens an.“, erklärte Breuninger. „Und jetzt, darf ich euch bitten, mir zu erläutern, was ihr hier in diesem Lager zu suchen habt? Für Spione seht ihr mir jedenfalls ein bisschen zu jung aus... auch wenn ich den Russen alles zutrauen würde.“
Während Bastian und Benja abwechselnd erzählten, wie stark sich ihr Leben in den letzten Wochen verändert hatte, und wie sehr sie der Zirkus und die Idee von Utopia beeindruckt hatte, hörte der Kommandant geduldig zu, ohne die beiden zu unterbrechen.
Er hatte die Hände zusammengefaltet und saß schon beinahe andächtig hinter seinem großen Schreibtisch.
Erst, als die beiden ihre Geschichte beendet hatten, räusperte sich Breuninger und sah prüfend zu ihnen auf.
„Ihr habt Mut, das muss man euch schon zugestehen! Auch wenn ihr offensichtlich verblendet seid. So etwas... kann einfach nicht funktionieren. Es darf nicht funktionieren. Wenn ich mir das vorstelle: Alle wären gleich... ha! Ich kenne eine Menge Menschen, die damit niemals klarkommen könnten. Niemals. Sie würden lieber die ganze Welt in Trümmern legen, als eine Idee wie euer Utopia zu akzeptieren. Glaubt mir... ihr ahnt gar nicht, wie viele Menschen sich in unserer Nation nur noch dadurch definieren können, dass sie anderen Befehle geben dürfen.“
„Wenn sie das in irgendeiner Weise stört... warum sind sie dann Oberst geworden?“, fragte Bastian kritisch, ohne den Kommandanten aus den Augen zu lassen.
Der erhob sich und sah aus einem kleinen Fenster hinaus auf den Hof.
„Ich bin Soldat. Ich habe keine Probleme damit, Befehle zu befolgen oder welche zu erteilen. Aber... es fällt nicht immer leicht, diese Befehle auch zu begreifen. Wisst ihr… früher gab es auch im schlimmsten Gefecht noch so etwas wie Anstand und Ehre. Heute ist davon nicht mehr viel zu spüren. Leute wie Gründlich beherrschen unser Land. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind das alles weltfremde Bürokraten. Und in Amtsstuben kennt man nunmal weder Kameradschaft noch Moral... geschweige denn Leid und Schmerzen.“
Er sah beinahe wehmütig zu Bastian und Benja herüber.
„In gewisser Weise beneide ich euch wirklich, Jungs. Um eure Freiheit, die ich niemals wieder haben werde... und um dieses Gefühl, Helden zu sein. Auch ich kannte das mal. Ich glaubte, mit jedem neuen Orden, den ich verliehen bekam, würde dieses Gefühl stärker werden. Doch das Gegenteil war der Fall.
Ihr könnt wahrscheinlich nicht verstehen, warum ich trotzdem noch daran festhalte. Aber das ist vielleicht auch besser so. Macht, dass ihr hier weg kommt... ihr seid frei!“
Bastian und Benja sahen sich fragend in die Augen... dann nickten sie einander wortlos zu.
„Wir werden nicht gehen.“, erklärte Bastian dem verdutzten Kommandanten. „Nicht ohne die Leute aus dem Zirkus!“
Breuninger warf den beiden einen strengen, beinahe abfälligen Blick zu. Zuerst schien es, als wollte er ihnen eine wütende Standpauke halten... doch dann besann er sich und erhob sich langsam von seinem Schreibtisch.
Er starrte auf das Bild von Adolf Hitler... bevor er es in die Hand nahm und vorsichtig umdrehte.
„Ach, wenn es in der Wehrmacht doch nur mehr Jungs von eurem Format geben würde...“, murmelte er gedankenverloren. „Gott weiß, welche Großtaten diese Armee hätte vollbringen können.“
„Jungs von unserem Format ordnen sich niemandem unter.“, entgegnete ihm Benja trotzig. „Also vergessen sie’s!“
Breuninger lächelte. Dann setzte er sich wieder hin und begann, von Hand einige Zeilen auf ein Blatt Papier zu schreiben. Nachdem er einen dicken Stempel daraufgesetzt hatte, reichte er den Schrieb der Wache, die sich noch im Raum aufhielt.
„Gehen sie raus, und sagen sie Gründlich, dass er sich sofort um die Freilassung dieser Insassen kümmern soll!“
Bastian konnte es kaum glauben.
„Danke... Glauben sie uns, sie haben das Richtige getan!“
„Wenn ihr mal da seid, wo ich jetzt bin, dann ist nichts mehr richtig.“, entgegnete der Kommandant verbittert. „Und jetzt holt eure Freunde und verschwindet von hier, bevor ich es mir noch anders überlege!“
Draußen war der Himmel mittlerweile zugezogen. Regen lag in der Luft. Der aufpeitschende Wind ließ Haare und Mäntel der Anwesenden ungestüm hin und her wirbeln.
Der große Lagerhof wirkte beinahe verlassen. Die Häftlinge schienen längst wieder in ihren Baracken oder bei der Arbeit zu sein. Nur ein kleiner Trupp von etwa einem Dutzend Gefangenen und vier Soldaten marschierte noch über den feuchten Sandboden.
„Da habt ihr eure Zigeunerfreunde. Zumindest alles, was noch übrig ist.“, giftete Gründlich zu Bastian und Benja hinüber. Es war ihm deutlich anzumerken, dass er für die Entscheidung seines Kommandanten keinerlei Verständnis hatte.
Bastian schaute prüfend in die Menge. Er erkannte Cäsar und Gabriel, die beide ziemlich geschwächt wirkten... und einige der anderen Leute aus dem Zirkus. Nur von einer Person fehlte jede Spur.
„Da war ein Mädchen... Sarah Crohn. Ist sie nicht hier?“, fragte Bastian den Vizekommandanten hoffnungsvoll.
Doch der grinste nur.
„Kinder, Frauen und Alte werden hier nicht benötigt. Sie wurde gleich zu Beginn ausselektiert.“
„Ausselektiert?“, mischte sich Benja ein. „Was heißt das? Dass sie wieder freigelassen worden ist?“
Jetzt lachte Gründlich erst richtig los... so, als habe ihm Benja den besten Witz aller Zeiten erzählt.
„Nein, du kleiner Dummkopf!“, spottete der Vizekommandant herablassend. „Ausselektiert bedeutet, dass sie in dieser Welt nicht mehr benötigt wird. Ich erklär dir mal, wie das läuft:
Also, deine Freundin wurde in einen Zug gesteckt, der direkt nach Auschwitz-Birkenau fuhr. Dort musste sie ihre Kleider ausziehen. Man hat sie mit hundert anderen Juden in eine große Kammer geführt. Ist es nicht lustig? Ihnen wurde erzählt, dass sie sich dort duschen und saubermachen konnten. Und dann... dann kam das Gas... tschhhhhhhh...“
Gründlich sah mit weit geöffneten Augen in den Himmel hinauf. Offensichtlich faszinierte ihn diese Vorstellung, denn er breitete seine Hände aus und begann, ergriffen weiter zu erzählen.
„Es kam ganz langsam. Zuerst wird sich deine Freundin gefragt haben: Was ist das für eine stickige Luft hier drin? Dann begann die Panik. Immer mehr mussten sich übergeben. Einige warfen sich verzweifelt gegen die Türe, doch ohne Erfolg. Und dann... tschhhhhhh... unentwegt dieses Geräusch. Tschhhhhhhh... Deiner Freundin fiel es sicher zunehmend schwer, zu atmen. Sie kroch röchelnd, auf allen Vieren, über den Boden und schrie verzweifelt. Wer weiß... vielleicht ist das letzte, was sie in ihrem Leben gerufen hat, dein Name gewesen...“
Benja hatte Tränen in den Augen.
„Du verdammtes Schwein!“, schrie er Gründlich wütend ins Gesicht. „Ihr seid doch alle geistesgestörte Mörder. Man sollte mit euch genau das Gleiche machen... Ja, genau das Gleiche!“
Bastian legte Benja mahnend seine Hand auf die Schulter.
„Hey, beruhig dich wieder. Wir müssen jetzt an Cäsar und die anderen denken. Lass dich nicht von dem Arsch provozieren... das ist doch genau, was er will. Dass wir ihm an die Kehle springen und er einen Grund hat, uns erschießen zu lassen.“
Benja wischte sich empört einige Regentropfen aus dem Gesicht.
Er schaute auf die vielen grimmig dreinschauenden Wachen, die um sie herum versammelt waren. Sie standen vor dem Tor, auf den Wachtürmen, entlang der Lagermauer... und alle schienen sie begierig darauf zu sein, den unerwünschten Eindringlingen eine Ladung Blei zu verpassen.
„Lass uns von hier verschwinden.“, flüsterte er leise zu seinem Freund hinüber. „Ich habe ein ganz mieses Gefühl im Bauch.“
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 10 - Jedem das Seine
Langsam öffnete sich das große, stacheldrahtbewehrte Holztor.
Bastian und Benja hatten zwei der schwächeren Zirkusleute in ihre Mitte genommen, um sie auf dem Weg nach draußen stützen zu können. Cäsar, der ebenfalls nur noch mit großen Mühen gehen konnte, hatte sich bei Gabriel eingehakt. Obwohl Gabriel, dessen Gesicht von blauen und grünen Blutergüssen überzogen war, ganz offensichtlich eine Menge hatte einstecken müssen, wirkte er noch kräftig genug, um das Gewicht des alten Zirkusdirektors mitzutragen.
Das Unwetter wurde allmählich stärker, und in der Ferne donnerte es bereits. Mit jedem zusätzlichen Tropfen, der vom Himmel fiel, weichte der bereits jetzt schon schlammige Boden noch mehr auf und erschwerte den Freunden das Vorankommen zusätzlich.
Nach einigen Metern hatten sie endlich das Tor passiert. Die Wachen blickten stoisch auf den langsam an ihnen vorbeilaufenden Haufen. Fast wie versteinerte Dämonen, dachte Bastian... der aus ihren Gesichtern keinerlei Emotionen herauslesen konnte.
Dann standen sie schließlich auf einer freien Fläche vor dem Lager. Der Wald schien in greifbare Nähe gerückt zu sein.
Nur noch ein paar Schritte, und sie hätten es geschafft.
„Halt, stehen bleiben!“, hörten sie auf einmal Gründlichs Stimme hinter ihrem Rücken.
Benja zuckte zusammen.
„Was ist... sollen wir rennen?“, flüsterte er Bastian unsicher zu. Doch der wiegelte ab.
„Nein, das schaffen die anderen nicht. Bleib ruhig, lass uns erst mal schauen, was er will.“
Sie drehten sich zu dem Vizekommandanten um, der ihnen alleine, ohne Begleitung seiner Soldaten, gefolgt war. Angesichts der schwerbewaffneten Truppen, die sich nur wenige Meter hinter ihm befanden, war dies allerdings auch nicht notwendig gewesen.
„Ihr kleinen Bastarde glaubt wirklich, dass ihr euch so einfach davonstehlen könnt, was?“, herrschte sie Gründlich mit hasserfüllter Stimme an. „Ihr habt mich vor dem gesamten Lager lächerlich gemacht... habt öffentlich meine Autorität angezweifelt!“
„Und das soll jetzt unsere Schuld sein, ja?“, platzte es wütend aus Benja heraus. „Sehen sie es mal so: Wenn sie nicht angefangen hätten, andere Menschen herumzukommandieren, hätte niemand ihr Recht, dies zu tun, in Frage gestellt. Um ehrlich zu sein, ich scheiß auf ihre Autorität! Sie werden am Ende verrecken wie alle anderen Menschen auch. Als tattriger Greis ohne Zähne, der gefüttert und gewaschen werden muss. Also warum machen sie sich die ganze Mühe überhaupt?“
Gründlich reagierte nicht.
„Ganz ehrlich...“, erklärte Benja weiter. „Machtausübung ist meiner Meinung nach eine ziemlich üble Zeitverschwendung! Besuchen sie mal den Zirkus Utopia, wenn er wieder steht... dann kapieren sie vielleicht, was ich meine.“
Auf einmal blitzte in Gründlichs Augen der blanke Hass auf.
Ohne weiter auf den Befehl seines Kommandanten zu achten, zog er seine schwarze Pistole aus der Tasche und schoss Benja mitten ins Gesicht.
Der laute Knall zerriss jäh die trügerische Stille, die sich über das ganze Lager gelegt zu haben schien.
Wie in Zeitlupe sah Bastian seinen besten Freund auf die Knie fallen. Benjas Körper zuckte, und überall um ihn herum war Blut. Blitzschnell hechtete Bastian zu ihm.
++++++++++
„Aber Basti, hör mir gut zu: Eines Tages werde ich mich nicht mehr schlagen lassen... von niemandem! Dann werde ich nämlich groß und stark sein, mich aufrecht vor sie hinstellen und einem jeden ins Gesicht spucken, der mich zu irgendwas zwingen will.“
„Du würdest sogar auf Hitler spucken?“, fragte ich fasziniert, obwohl ich mir die Antwort ja denken konnte.
„Ich, mein lieber Basti,“, antwortete Benja pathetisch, „Ich werde eines Tages stark genug sein, um sogar einem neunköpfigen Drachen ins Gesicht spucken zu können!“
„Und wenn er dich dann frisst?“
Benja sah mich mit gespieltem Ernst an.
„Dann soll er daran ersticken!“
Daraufhin mussten wir beide laut loslachen. Ich, weil es mich immer wieder amüsierte, was für einen Blödsinn man reden konnte, wenn man betrunken war, und Benja... ich weiß es nicht. Ich glaube, er lachte aus einem anderen Grund.
++++++++++
„Nur, damit ihr dort nicht vergesst, was Autorität bedeutet!“, erklärte Gründlich höhnisch und wandte sich ab, um wieder zurück ins Lager zu gehen.
Bastian drückte den Kopf seines Freunde fest an sich.
„Benja... Benja...!“, brüllte er. Doch er bekam keine Antwort. Benja war bereits tot.
Rasend vor Zorn griff Bastian in die Hose seines Freundes, bis er dessen Revolver in seinen Händen spürte.
Mit einem lauten Schrei sprang er auf, richtete die Waffe in Richtung des sichtlich erschrockenen Gründlich und feuerte.
Zwei Kugeln schlugen vor dem Vizekommandanten auf dem Boden ein... die dritte traf ihn am Arm unterhalb der Schulter. Dann eröffneten die am Tor versammelten Wachen das Feuer. Mehrere Gefangene wurden von Schüssen getroffen und fielen zu Boden. Als Bastian das sah, feuerte er weiter... jetzt auch auf die anderen Soldaten.
Von einem der Wachtürme ratterte ein Maschinengewehr los. Die Salve näherte sich Bastian und schlug schließlich in seinen Beinen ein. Bastian spürte den rasenden Schmerz und starrte geschockt auf die Fleischfetzen, die aus seinem Oberschenkel und dem Knie herausgerissen wurden... dann knickte er vorneüber weg und landete mit dem Gesicht in einer großen Schlammpfütze.
Cäsar riss sich mit letzter Kraft von Gabriel los, um Bastian unter die Arme zu greifen. Doch noch bevor er ihn erreicht hatte, trafen auch ihn mehrere Geschosse in der Brust.
Der alte Zirkusdirektor stürzte leblos zu Boden.
Zwei der anderen gelang es schließlich, Bastian aufzuhelfen und mit ihm im Schlepptau trotz der rings um sie herum einschlagenden Kugeln den schützenden Wald zu erreichen.
Die Soldaten folgten ihnen nicht. Sie zogen sich vielmehr geordnet ins Lager zurück und schlossen das große hölzerne Tor, nachdem sie das Feuer eingestellt und ihren Vizekommandanten aus der Gefahrenzone gebracht hatten.
Am Ende haben von den dreizehn Gefangenen, die Bastian und Benja befreit hatten, nur fünf überlebt.
Einer von ihnen kannte einen Fluchtweg, auf dem sie Polen verlassen konnten. Endlose Tage lang schleppte er sich zusammen mit zwei weiteren Zirkusleuten und dem schwer verwundeten Bastian durch die Gegend. Mit Hilfe einiger freundlich gesinnter Bauern gelang es ihnen schließlich, die Küste zu erreichen und auf einem Fischerboot ins sichere Schweden überzusetzen.
Von Gabriel fehlte lange Zeit jede Spur. Bekannt war nur, dass er sich ziemlich schnell von den anderen getrennt hatte und alleine in die Berge geflüchtet war.
Oberst Breuninger, der Kommandant des Lagers Bragowizce, erschoss sich am 7.5.1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Reiches.
Vizekommandant Gründlich dagegen setzte sich schon Wochen vor Kriegsende von seiner am Rhein stationierten Einheit ab, um unterzutauchen und später mit einem anderen Namen ein neues Leben zu beginnen.
Bastian wurde wenig später in ein Militärlazarett in England gebracht, wo er monatelang behandelt werden musste.
Nach langer Zeit hatte er sich soweit erholt, dass er mit Hilfe von Krücken wieder notdürftig gehen konnte. Aber den Tod von Benja hatte er nicht verkraftet.
Das viele Morphium, das Bastian verabreicht worden war, hatte ihn längst abhängig gemacht. Und die Menschen, die sich um ihn herum befanden, nahm er nur so lange wahr, wie er noch Hoffnung hatte, dass es sich bei ihnen um seinen verkleideten Freund handeln könnte. Doch sobald er dann einmal in ihre Augen geblickt hatte, ignorierte er sie.
Im Sommer 1948 war Bastian nur noch ein Wrack. Ein junger Mann, der sämtliche Drogen nahm, die er finden konnte, und der ansonsten den ganzen Tag über nichts anderes tat, als auf der Straße zu sitzen und ungesund lange in die Sonne zu starren.
Seine Sehkraft war bereits stark in Mitleidenschaft gezogen, als ihn schließlich irgendwann eine Polizeistreife aufgriff und in eine Heilanstalt für Geisteskranke einlieferte. Dort verbrachte Bastian weitere Monate in einer engen Zelle, weil er gleich nach seiner Ankunft einem der Ärzte an die Gurgel sprang und ihm ein Ohr abbiss.
Tag ein, Tag aus schlug er seinen Kopf gegen die weiche Gummiwand und schrie den Pflegern auf dem Gang zu, dass sie alle Nazis wären und ihn endlich ausselektieren sollten.
„Na los, ihr verfickten Totenköpfe! Vergast mich doch, wenn ihr euch traut! Tschhhh.... tschhhhh...“
Fast jeder Mensch hat einen Stern, der für ihn leuchtet, und von dem er seine ganze Kraft bezieht. Einen lebenden, atmenden Stern. Für ein Kind mag das die liebende Mutter sein, für einen Egoisten sein Spiegelbild, für einen Nazi der beschissene Adolf Hitler höchstpersönlich.
Und für Bastian war Benja dieser Stern, der an seinem Himmel thronte, und der ihm in schwierigen Zeiten den Weg wies.
Doch nun war Benja für immer untergegangen... und Bastian mit ihm.
Er lag auf dem Boden und starrte wieder einmal ausdruckslos an die Decke, als sich mit einem kräftigen Ruck die weiße Türe öffnete.
Zuerst sah Bastian nur einen elegant gekleideten Gentleman vor sich stehen, mit gestreiftem Jacket, blitzenden Schuhen und einer Melone auf dem Kopf.
„Du beschissener Nazi-Snob, verpiss dich von hier!“, brüllte er wütend in Richtung des unerwünschten Besuchers. Doch der kümmerte sich nicht weiter darum, und lief stattdessen lässig auf Bastian zu, bis er schließlich unmittelbar vor ihm zum Stehen kam.
„Was ist... glaubst du immer noch an das Paradies, Hitlerjunge?“
Bastian kannte diese Stimme... noch immer, auch nach all der Zeit. Es war Gabriel!
Angestrengt bemühte sich Bastian darum, sich aufzurappeln und in seinem verschwommenen Blickfeld ein Gesicht erkennen zu können. Es dauerte einige Zeit, bis er wieder einigermaßen klar sehen konnte. Aber dann bestand für ihn kein Zweifel... vor ihm stand der verwahrloste Messerwerfer von einst. Nur dass er von seiner äußeren Erscheinung her kaum mehr wiederzuerkennen war.
„Gabriel...“, flüsterte Bastian leise. „Was ist denn... mit dir passiert?“
„Nein, sag mir lieber, was mit dir passiert ist, Hitlerjunge! Ich habe ziemlich lange suchen müssen, um dich hier zu finden. Glaub mir, ich ließ sogar in Oxford nachfragen... du warst früher so hoffnungsvoll und optimistisch, ich war mir fast sicher, du würdest studieren und das Leben in der neuen Umgebung genießen. Aber dann... dann komme ich hier rein und sehe einen völlig mit Medikamenten vollgepumpten Krüppel in einer Lache aus Pisse auf dem Boden liegen.“
Bastian tastete vorsichtig nach Gabriels Arm. Er fühlte sich so real, so lebendig an.
„Gibst du mir ein Messer?“, flüsterte er leise. „Ein Messer... damit ich mir den verdammten Hals aufschlitzen kann!“
Gabriel ging kopfschüttelnd in die Knie.
„Ich habe dir gesagt, wie das Leben ist. Verstehst du jetzt, warum ich lieber eine Hyäne sein möchte?“
Bastian sank benommen zurück.
„Sei eine gute Hyäne und reiß mich!“
„Tut mir leid... aber ich töte von jetzt an nur noch Menschen, die es verdient haben.“, erwiderte Gabriel kalt.
„Verstehe...“, lallte Bastian verächtlich.
„Und davon lässt sich anscheinend ziemlich gut leben.“
„Ach, der Anzug? Glaub mir, der Vorbesitzer hatte es definitiv verdient.“, meinte Gabriel und stand wieder auf, um einige Schritte um Bastian herum zu gehen.
„Du beschissener Zyniker... verschwinde endlich, bevor ich dir deinen schicken Hut in den Arsch ramme.“, flüsterte Bastian und vergrub gelangweilt den Kopf hinter seinen Armen.
„Na los, geh schon! Ich beachte dich ohnehin nicht länger.“
„Schon klar...“, antwortete Gabriel gefasst. „Du beachtest mich nicht. Du liegst nur hier rum und verfluchst die ganze Welt. Und, versteh mich nicht falsch... das ist auch an sich gar nicht mal schlecht. So habe ich schließlich mein halbes Leben verbracht. Aber... ich habe nie meine Würde verloren, so wie du.“
Dann kippte er Bastian ein großes Glas Wasser über den Kopf.
„Spinnst du?“, brüllte Bastian außer sich. „Du weißt wohl nicht, dass ich gefährlich bin, was? Mit mir ist nicht zu Spaßen, wenn ich wütend werde, glaub mir!“
Gabriel achtete nicht weiter auf Bastians Provokationen. Er reichte ihm ein Tuch, um sich abzutrocknen, und warf ihm danach eine Zeitung vor die Füße.
„Was ist, kannst du noch lesen, Hitlerjunge?“
Das war zuviel für Bastian. Er sprang wie vom Blitz getroffen auf und schlug mehrmals mit der Faust gegen Gabriels Brust. Doch er hatte natürlich keine Chance gegen den gesunden und älteren Gabriel.
Bastian wurde von ihm gegen die Wand gestoßen... dann traf ihn irgendetwas Hartes am Kopf und ließ ihn wie einen nassen Sack zusammenklappen.
Stunden später, als Bastian aufwachte, befand er sich in einem ihm unbekannten, holzgetäfelten Raum. Es roch nach geröstetem Speck, und statt dem weißen Hemd aus der Anstalt hatte er auf einmal einen ebenso vornehmen Anzug an wie Gabriel.
Verwirrt tastete er sein Gesicht ab und bemühte, diese dunklen Flecken, die er ständig sah, von seinen Augen abzuwischen.
Er lag offensichtlich auf einem weichen Bett. Vorsichtig hob er mit den Händen sein rechtes Bein an, um es auf dem Boden abzustützen, und rutschte in Richtung der Kante.
Ein lautes Rascheln machte ihn auf die Zeitung aufmerksam, die noch immer aufgeschlagen vor ihm lag.
Es war eine Zeitung aus der Heimat.
„Der Krieg ist aus...“, murmelte Bastian. Er hatte es natürlich schon damals mitbekommen, allerdings mittlerweile wieder vergessen gehabt.
„Man spielt wieder Fußball.“
Außer den Überschriften konnte er nichts erkennen, dafür waren die anderen Buchstaben viel zu klein. Doch ihm genügte es ohnehin, die Bilder anzuschauen. Er hatte in den letzten Monaten nichts mehr gesehen gehabt, was außerhalb der englischen Großstadt existierte.
Weiter unten auf der Seite waren mehrere Staatsmänner beim Händeschütteln abgebildet... offensichtlich irgendeine Konferenz oder so etwas in der Art. Bastian wollte schon weiterblättern... doch dann zuckte er plötzlich unwillkürlich zusammen.
Da war das Foto eines Mannes, dessen Gesicht er auch in hundert Jahren Irrenhaus nicht vergessen würde...
„Christdemokrat Robert Kramer neuer Bürgermeister.“, verkündete die dazugehörige Schlagzeile knapp. Aber es war nicht Robert Kramer.
Es war Oswald Gründlich.
„Du siehst... Scheiße schwimmt immer oben.“, wurde Bastian von Gabriels eindringlicher Stimme aus seinen Gedanken gerissen.
„Warum hat man... ihn... nicht...“, stammelte Bastian verwirrt.
Gabriel lächelte.
„Warum man ihn nicht bestraft hat? Na, was denkst du wohl? Weil er vergessen hat, dass er ein Nazi war! Er ist jetzt ein guter, christlicher Mitläufer mit dem Namen Kramer.“
Bastian reagierte nicht. Er starrte nur still an die Wand und zuckte unkontrolliert mit den Augenlidern.
Langsam begann Gabriel ungeduldig zu werden.
„Also gut... ich arbeite für eine jüdische Geheimorganisation! Wir sind da, um die Sühne, die uns das deutsche Volk schuldig geblieben ist, mit Gewalt einzufordern. Und ich... ich bin in dieser Vereinigung der Mann fürs Grobe. Wie im Zirkus, verstehst du? Ich tue mal wieder das, was ich am Besten kann: Schweigen und töten.“
„Dann töte ihn!“, flüsterte Bastian und deutete auf das Foto von Gründlich.
Gabriel setzte sich behutsam zu ihm aufs Bett.
„Ja, genau das werde ich auch tun. Ich dachte nur... den ersten Schuss sollte ich dir überlassen.“
Er klopfte Bastian auffordernd auf die Schulter.
„Komm mit mir zurück nach Germanien, Hitlerjunge! Wir treiben die alte Schuld ein... und dann kannst du meinetwegen wieder heim in deine Gummizelle, wenn du dich dort so wohl fühlst.“
Bastian schwieg eine Weile... dann warf er Gabriel einen wütenden Blick zu.
„Ich heiße Bastian... und nicht Hitlerjunge. Klar?“
Die Sitzung des zum ersten Mal nach dem Krieg nur noch von Deutschen geführten Stadtrates hatte Robert Kramer einstimmig als neuen Bürgermeister bestätigt.
„Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit unser Land aus den Ruinen auferstehen und wieder so prächtig werden wird, wie es einstmals gewesen ist!“, hatte Kramer unter tosendem Beifall der Delegierten verkündet.
„Was vergangen ist, ist vergangen. Wir sollten uns jetzt, anstatt weiter das viele Leid der Kriegsjahre vor Augen zu haben, lieber der Zukunft zuwenden. Damit unsere Kinder und Enkel eines Tages wieder stolz auf ihr deutsches Vaterland sein können.“
Die vielumjubelten Worte schienen auch noch lange nach der Rede durch die weiten Gänge des großen Rathauses zu hallen. Wenige Jahre nach Ende des Krieges waren die Deutschen bereits wieder Weltmeister... hauptsächlich darin, so zu tun, als ob es nie einen Krieg und eine Diktatur auf deutschem Boden gegeben hätte.
Schon damals zeichnete sich ab, was sich wie ein roter Faden durch die gesamte Adenauer-Ära ziehen sollte. Schuld waren immer nur die anderen. Die, die man in Nürnberg verurteilt hatte, oder die bereits noch im Krieg von den Alliierten erschossen worden waren. Wer überlebt hatte und in keiner rechtsradikalen Partei war, konnte kein Nazi sein. Besser gesagt, er durfte es einfach nicht.
Wer irgendetwas anderes behauptete, war ein Kommunist. Ein Feind des Aufschwungs, ein Feind des Wirtschaftswunders... so einfach machte man es sich damals. Und so war Gründlich bzw. Kramer bei weitem nicht der einzige Unmensch, der in dieser Zeit als Mitglied der CDU oder einer anderen aufstrebenden Partei Karriere machte.
Gründlich lief grinsend durch die weite Eingangshalle.
Er hatte es wieder einmal geschafft! Egal ob als Nazi oder überzeugter konservativer Demokrat... er war immer eine Autoritätsperson, die viel Macht und Einfluss auf andere Menschen hatte. Und selbst, wenn eines Tages die Kommunisten die Macht in Deutschland an sich reißen würden: Gründlich wusste, dass er dann innerhalb kürzester Zeit einer ihrer obersten Genossen sein würde.
Es war längst wieder ziemlich leer in dem Gebäude geworden. Nur Gründlich und sein persönlicher Leibwächter, den er noch aus der Zeit in Bragowizce kannte, hielten sich noch im Inneren auf. Und da war noch ein englischer Gentleman, der lässig an einer Wand vor der gläsernen Eingangstüre lehnte.
Als Gründlich und sein Leibwächter in etwa auf seiner Höhe waren, richtete sich der junge, langhaarige Mann plötzlich auf und stellte sich ihnen drohend in den Weg. Gründlichs Begleiter rief dem unerwünschten Besucher etwas zu, doch der antwortete nicht. Stattdessen sprang mit einem metallischen Klick das Klappmesser auf, das er unter seinem weitgeschnittenen dunklen Mantel versteckt hatte, und bohrte sich mit einem präzisen Stich tief in den Hals des bulligen Leibwächters.
Der fasste sich im Todeskampf an die heftig blutende Wunde, kroch noch ein paar Meter kraftlos über den kalten Marmorboden, bevor er schließlich einen krächzenden Laut von sich gab und leblos zusammenbrach.
Gründlich starrte entsetzt in Gabriels diabolisch grinsendes Gesicht.
Panisch wich er einige Schritte zurück. Dann rannte er, so schnell er konnte, davon, um in den verzweigten Gängen des Rathauses Schutz oder Hilfe zu suchen. Doch kurz, bevor er die nächste Ecke erreicht hatte, stellte sich ihm genau aus dieser Richtung kommend eine zweite Person in den Weg.
Die Gestalt humpelte ihm langsam entgegen, immer auf ihren edel aussehenden Spazierstock gestützt. Es war Bastian, der eine schwarze Pistole in seinen Händen trug und ohne eine Miene zu verziehen direkt auf Gründlichs Kopf zielte.
„Du...“, zischte Gründlich hasserfüllt. „Sag schon... was wollt ihr? Was soll das hier werden?“
Bastian blieb kurz vor dem Nazi stehen. Er schielte zu Gabriel herüber, der jetzt ebenfalls eine Pistole in der Hand trug und von der anderen Seite her auf Gründlich zielte.
„Ich stelle ihre Autorität in Frage.“, murmelte Bastian. Er dachte an Benja, an Cäsar, und an Sarah... an alles, was nie wieder sein würde.
Dann feuerte er.
Gleich darauf begann auch Gabriel zu schießen. Von beiden Seiten schlug das Blei in Gründlichs Körper ein und riss hässliche ausgefranste Löcher in seine weiße Weste. Gründlich zuckte wie unter Strom, bis die beiden Freunde schließlich das Feuer einstellten. Taumelnd prallte Gründlich gegen die hinter ihm befindliche Wand und schmierte langsam daran zu Boden.
Bastian war überrascht, wie befriedigend es sein konnte, einen verhassten Menschen zu töten. Er beugte sich eiskalt zu dem toten Politiker herunter und schoss ihm noch eine letzte Kugel in den Kopf.
Mit einem Mal war es totenstill in der Eingangshalle. Aus den Einschusslöchern in Gründlichs Körper stieg immer noch grauer Rauch auf. Dann ging auf einmal eine schrille Alarmglocke los, die irgendjemand ausgelöst haben musste... und Gabriel und Bastian verschwanden so unauffällig wie sie gekommen waren in den anonymen Straßen der Großstadt.
Natürlich kehrte Bastian nicht in seine Gummizelle zurück.
Er gewöhnte sich allmählich wieder an das Leben und begleitete Gabriel bei dessen Aufträgen für die Organisation.
Bastian konnte es kaum glauben, wie wenig sich die Mehrheit der Bevölkerung für das Regime zu schämen schien, das sie alle jahrelang unterstützt oder doch zumindest schweigend toleriert hatten. Im Dritten Reich versteckten sich alle in der Masse der Uniformierten... und nun versteckten sich genau die selben Leute in der Masse derer, die nie eine Uniform besessen haben wollten.
Doch fast genauso schockiert wie über die Feigheit der Menschen war Bastian von der zunehmenden Brutalität, mit der Gabriel gegen Andersdenkende vorging. Wo es zunächst nur einzelne Mordaufträge waren, die wirklich schlimmen Kriegsverbrechern galten, gerieten mehr und mehr auch unschuldige Passanten ins Schussfeld der Organisation.
„Die Deutschen verstecken sich immer gern in der Herde.“, erklärte Gabriel einmal im betrunkenen Zustand. „Also schießen wir doch einfach auf die Herde... und es werden immer die Richtigen fallen! Denn was ist eine Herde denn schon anderes als die Summe aller Menschen, die sich in die Anonymität flüchten, um sich nicht für ihre Taten verantworten zu müssen?“
Als kurze Zeit darauf bei einem missglückten Anschlag mehrere Streifenpolizisten von einer Salve aus Gabriels Maschinenpistole niedergestreckt wurden, war für die amerikanischen Besatzer das Maß voll. Der US-Militärgeheimdienst begann, sich in die Ermittlungen einzuschalten... Depots wurden offengelegt, Zeugen befragt, Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Und je dünner die Luft für Gabriel, Bastian und die anderen Mitglieder der Organisation wurde, um so mehr wurden die sich anfangs zweifellos im Recht befindlichen Rächer zu verbitterten Gewalttätern. Aus Selbstjustiz wurde Terror... aus dem Kampf gegen den Faschismus wurde der Kampf gegen alles, was irgendwie deutsch und autoritär aussah.
Bastian begann, sich in der Gesellschaft seiner neuen Freunde zunehmend unwohl zu fühlen. Er hatte längst bemerkt, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch unter welchen Fanatikern er sich tatsächlich befand, sollte er erst erkennen, als es schon beinahe zu spät war...“
Kapitel 11 - Besuch aus der Vergangenheit
„Was ist?“, frage ich Saphire, als der seine Erzählung unterbricht und prüfend zur Türe schaut.
„Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe irgendein Geräusch gehört.“
Ich schaue auf die Uhr. Bald halb vier Uhr morgens.
„Sind das vielleicht ein paar der Kleinen? So wie ich Utopia bisher kennengelernt habe, gibt es bei euch sicher keine Bettruhe ab 21 Uhr oder ähnliches.“
Saphire lächelt mir vielsagend zu.
„Du wärst überrascht, wie viel kleine Kinder schlafen, wenn sie nur von niemandem dazu gezwungen werden.“
„Ohne Zwang scheint ja vieles besser zu gehen.“, entgegne ich beeindruckt.
Vielleicht sollte man Utopia zur Staatsreligion machen.
Ja, wenn es keine Zwänge gäbe, würde ich jetzt wahrscheinlich noch mit Robin, Little John und den anderen im Baumhaus sitzen... und keinen würde es kümmern, ob wir dafür zu alt sind oder nicht.
Niemand würde mich zwingen, eine Ausbildung zu machen, die ich nicht mag. Und mein Vater müsste sich nicht mehr um meine Zukunft sorgen.
Müde folge ich Saphire durch die dunklen Gänge.
Nur der helle Kegel einer Taschenlampe beleuchtet den vielen abgestellten Krempel, an dem wir vorbei in Richtung der Haupthalle schleichen.
„Manchmal spielen die Kleinen tatsächlich gerne Verstecken mit uns. Nur zu so einer Uhrzeit... das ist schon ein wenig ungewöhnlich.“, erklärt mir Saphire leise.
Ich taste mich an der Wand entlang weiter nach vorne, bis wir endlich im großen Speisesaal angekommen sind.
Auf einmal ist der ganze Raum in ein grellstrahlendes Licht getaucht. Ich halte mir schützend die Hand vors Gesicht und blinzele vorsichtig hindurch. Nur mühsam gelingt es mir, meine Augen an die unerwartete Helligkeit zu gewöhnen.
Vor mir stehen in Reih und Glied mehrere dunkle Schatten.
Saphire ruft einem von ihnen etwas zu... doch als Antwort erntet er nichts außer einem brutalen Faustschlag, der ihn nach hinten schleudert und kurz vor meinen Füßen auf den harten Boden aufkommen lässt.
Schmerzerfüllt windet er sich und fasst sich dabei fluchend an seinen eingegipsten Arm.
Ich will ihm aufhelfen... doch das eindringliche Klicken einer Schusswaffe veranlasst mich dazu, stattdessen stillzustehen und artig die Hände nach oben zu nehmen.
Langsam erkenne ich in den Schatten Konturen.
Es sind überwiegend junge Menschen, martialisch gekleidet und mit seltsamen bunten Sonnenbrillen bestückt. Einer von ihnen, ein Typ mit langen feuerroten Haaren, einem Ledermantel und einer in metallischem blau schimmernden Brille, hält drohend eine ziemlich futuristisch anmutende Pistole in meine Richtung.
„Ah, der alte Wächter ist ausgeflogen. Jetzt ist nur noch die junge Nachwuchsbrut im Haus...“, flüstert er begeistert.
„Du verdammtes Schwein...“, flucht der immer noch am Boden liegende Saphire empört. „Ich hatte gehofft, dich niemals wieder zu sehen!“
„Du kennst ihn?“, frage ich überrascht. „Hat der irgendwas mit euch zu schaffen?“
„Ich bin Asrael.“, erwidert der Rothaarige. „Ich spreche im Auftrag meines Vaters.“
Er deutet mit dem Kopf in eine Ecke des Raumes, in der sich eine weitere Gestalt befindet. Es ist ein alter Mann, mit langen, schneeweißen Haaren und einem Rauschebart, der mich ein wenig an den Zauberer Merlin erinnert.
„Ihr seid weit weg von Camelot, Mylord!“, rufe ich ihm herausfordernd zu. Doch Saphire krallt sich energisch an meinem Bein fest.
„Nicht, Notti... verhalt dich jetzt bloß ruhig! Der Typ da hinten... das ist Gabriel.“
Gabriel. Der Messerwerfer, der Terrorist, der stumme Zigeuner! Fasziniert schaue ich in seine stechenden Augen. Die ganze Geschichte von Bastian wirkte auf mich bis jetzt wie eine nette Sage aus vergangenen Tagen. Doch nun, wo einer der Haupt-Charaktere leibhaftig vor mir steht, wird mir erst so richtig bewusst, wie real das ganze Grauen in dem Lager und die Dinge danach für Bastian gewesen sein mussten.
„Notti...“, lacht Asrael spottend. „Du musst neu hier sein. Wir haben noch keinerlei Informationen über dich. Nun gut, dazu werden wir sicher noch kommen.“
„Was wollt ihr hier?“, fragt Saphire ungeduldig. „Hattet ihr nicht vor, eine Bombe hochgehen zu lassen?“
Asrael schüttelt amüsiert den Kopf.
„Aber nein, mein guter Saphi... das war nur ein nettes kleines Spiel, das wir mit euch gespielt haben. Euer alter Mann wird dort, wo er jetzt ist, weder eine Bombe noch irgendwelche Terroristen finden. Genauergesagt ist er der Terrorist... zumindest für das Sondereinsatzkommando, das vor dem Gebäude Stellung bezogen hat. Irgendjemand hat ihnen nämlich den Tip gegeben, dass heute die antifaschistische Brigade in Aktion treten wird.“
„Ich gehöre zwar nicht zu Utopia...“, antworte ich empört. „Aber ein jeder Verrat ist auch für den ein Schlag ins Gesicht, der nicht verraten wird!“
„Verrat...“, flüstert Asrael, der jetzt näher an mich herantritt und mit seiner Schusswaffe sanft über mein Gesicht streicht. „Du hast ja keine Ahnung. Verrat gibt es schon, seit sich mehrere Menschen auf Erden den selben Sauerstoff teilen müssen. Also warum sollten ausgerechnet wir eine Ausnahme machen?
Außerdem... wenn ich mich recht entsinne, war Bastian derjenige, der damals meinen Vater verraten hatte, und nicht umgekehrt. Was ist, Safirkind... hast du deinem Freund etwa noch nicht die glorreiche Geschichte von Bastians Verrat erzählt?“
„So weit bin ich noch nicht gekommen.“, zischt Saphire wütend.
„Vielleicht könnt ihr sie ja für mich zu Ende erzählen.“, meine ich und schaue dem mir eindeutig zu arrogant wirkenden Asrael eindringlich in die Augen.
Asrael dreht sich um und blickt fragend in die Gesichter seiner Kollegen. Daraufhin tritt einer von ihnen nach vorne und flüstert ihm irgendetwas ins Ohr.
„Na gut.“, meint er schließlich, wieder in meine Richtung gewandt. „So lange wir hier auf Bastians hoffentlich gesunde Rückkehr warten, können wir uns die Zeit ja mit ein wenig Vergangenheitsbewältigung vertreiben.“
Zufrieden beobachtet er seine Leute dabei, wie sie sich an strategisch wichtigen Positionen des Saales in Stellung bringen. Dann setzt er sich auf die Lehne eines Stuhles und beginnt gedankenversunken zu erzählen.
„Gabriel und Bastian waren in der Zeit nach dem Krieg ein prima Team. Doch nach dem Anschlag von Hannover, bei dem es ihnen gelungen war, einen der führenden Köpfe der Gestapo auszuschalten, begann sich Bastian zu verändern. Er fing an, das Ziel der Bewegung, nämlich Auge um Auge mit dem Deutschen Volk abzurechnen, zunehmend in Frage zu stellen.
„Mit Gründlich war das was völlig anderes, Gabriel.“, meinte er am Abend nach dem letzten Anschlag zu meinem Vater. „Bei ihm wusste ich, dass er es verdient hatte. Ich habe seine Schuld mit eigenen Augen gesehen... Aber heute... heute starben junge Männer wie wir, nur weil sie die falsche Uniform getragen haben.“
„Sie kamen dem Faschisten zur Hilfe.“, entgegnete Gabriel ungerührt. „Was erwarten die denn von mir? Dass ich ihre Gesetze respektiere? Wo waren sie und ihre Gesetze denn damals, als die Leute aus dem Zirkus wie Tiere zusammengetrieben und umgebracht worden sind?
Als ich schwach war, musste ich darunter leiden, dass auf der Welt das Recht des Stärkeren galt. Und jetzt, wo ich endlich selbst zu den Starken zähle und es ihnen heimzahlen kann, will man mir was von Menschenrechten und Demokratie erzählen? Oh nein, Hitlerjunge... so einfach lasse ich mich nicht abspeisen!“
Wenige Tage danach trafen sich Gabriel, Bastian und zwei weitere Männer in einer kleinen, gutbürgerlichen Kneipe mit Shlomo Weingarten, einem ausgemergelten jüdischen Chemiker, der in Auschwitz nur ganz knapp dem Tod entronnen war.
„Frauen... Kinder...“, flüsterte er. „Sie haben sie alle getötet.“
„Und wir töten nur ihre Soldaten.“, entgegnete ihm einer von Gabriels Gefolgsleuten grimmig. „Finden sie das fair?“
Weingarten schüttelte schweigend den Kopf und schüttete sich noch ein Glas Whiskey in den Rachen.
Nein, es war nicht fair. Aber es fiel ihm schwer, seine humanistische Erziehung zu vergessen und sich auf das Niveau der Menschen herabzulassen, die er über alles auf der Welt verabscheute.
„Gibt es denn keine andere Lösung, um Wiedergutmachung zu erlangen?“
Gabriel lief nachdenklich in der dämmrigen Gaststube auf und ab. Mittlerweile waren sie mit dem Wirt allein, denn es war schon kurz vor Sperrstunde.
„Aktion und Reaktion... die Prinzipien, nach denen alles funktioniert, mein guter Shlomo.“, erklärte er gelassen. „Die Frage ist doch: Sind wir stark genug, um auch nach diesen Prinzipien leben zu können... oder lassen wir uns von illusionären Dingen wie Menschlichkeit und Moral in Ketten legen? Und das nur, um unseren Feinden, die sich weitaus weniger um Moral und Menschlichkeit scheren als wir, einen Vorteil zu verschaffen?“
„Nein...“, antwortete Weingarten mit zitternder Stimme. „Du hast ja Recht, Gabriel. Wir dürfen ihnen gegenüber nicht verweichlicht sein... aber, was du vor hast... das ist Massenmord!“
Bastian wurde hellhörig.
„Hey, von was redet ihr da?“, fragte er Gabriel in energischem Tonfall.
„Wir hatten doch ausgemacht, dass wir alles gemeinsam planen, oder nicht? Und außerdem, warum sprichst du auf einmal mit diesem Typen da? Du bist doch sonst so besessen darauf, immer nur über Mittelsleute zu kommunizieren...“
„Halt dich da raus, kapiert?“, zischte Gabriel wütend zurück.
„Du kannst jederzeit gehen, wenn dir etwas nicht passt! Und das gilt auch für dich, Shlomo. Aber gib mir vorher die vereinbarte Lieferung...“
Shlomo Weingarten nahm seine Brille ab, um sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn zu tupfen.
„Möge Gott im Himmel uns allen vergeben.“, flüsterte er beinahe beschwörend, bevor er Gabriel einen Wagenschlüssel überreichte. „Der schwarze Ford mit Anhänger, unterhalb der Brücke... da ist alles deponiert, worüber wir gesprochen hatten. Ich wünschte, ich... hätte euch niemals kennengelernt.“
Dann ging er niedergeschlagen in Richtung Türe, ohne sich von Bastian, Gabriel oder einem der anderen zu verabschieden.
„He Shlomo!“, rief ihm Gabriel lautstark hinterher.
„Vergiss nicht, dass du dich in einer Woche um diese Zeit besser nicht mehr in dieser Gegend aufhalten solltest.“
„Warum denn nicht?“, mischte sich Bastian neugierig ein. „Was ist denn in einer Woche?“
„In einer Woche um diese Zeit ist der Ausgleich geschaffen.“, flüsterte Gabriel mit finsterem Blick. „6 Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder... mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden!“
Dann stand er auf, zahlte und ging.
Bastian, der noch immer nichts zu begriffen haben schien, sah ihm kopfschüttelnd hinterher. Er fragte sich, wie viele Bomben Gabriel wohl bauen müsste, um 6 Millionen unschuldige Menschen zu töten.
Erst, als der Wirt den Laden schloss, stolperte auch Bastian müde durch die dunklen Gassen der Stadt nach Hause.
„Schnell helft uns! Jamiro ist verwundet!“, ruft hektisch eine Stimme aus Richtung des Eingangs.
Ich fluche leise. Kann sich nicht einer mal erbarmen und mir die Geschichte zu Ende erzählen?
Kaum sehe ich mich um, steht auch schon der alte Bastian im Raum... Arm in Arm mit Jamiro, dessen blutverschmiertes Hemd nichts Gutes erahnen lässt.
„Wieso war der Eingang nicht gesichert?“, fragt Bastian. „Ihr wisst doch, dass...“
Doch dann verstummt er.
Er schaut kritisch auf Asrael, dann auf die weiteren Terroristen, die sich in seinem toten Winkel versammelt hatten.
Gabriel klatscht munter in die Hände.
„Sieh an... du bist alt geworden, Hitlerjunge!“
Er kann tatsächlich sprechen.
„Du auch, Gabriel.“, entgegnet Bastian verächtlich.
„Ja, wer hätte das damals gedacht...“
Saphire springt hastig auf, ohne noch weiter auf die ihn bedrohenden Terroristen zu achten. Wütend stößt er einen von ihnen zur Seite und stürzt auf Jamiro zu.
„Jam... was ist los? Wie geht es dir?“
Der flüstert irgendetwas, was ich von meiner Position aus nicht verstehen kann. So wie es aussieht, scheint er sich jedenfalls in einem halbwegs stabilen Zustand zu befinden.
Bastian winkt die zwei Begleiter zu sich, die dicht hinter ihm den Raum betreten hatten.
„Bringt Jamiro erst mal in sein Zimmer. Er braucht jetzt viel Ruhe... aber ich denke, er wird es überleben.“
Die beiden verlassen mit ihrem verwundeten Freund im Schlepptau den Raum. Nur widerwillig machen ihnen Gabriels Schergen den Weg frei.
„Lasst sie gehen.“, ruft Asrael, und beobachtet kritisch, wie auch Saphire seinen Freunden folgen will. „Aber behaltet sie im Auge! Und der großmäulige Skater bleibt hier... dem traue ich nämlich nicht über den Weg!“
Jetzt gehen auch zwei der Terroristen aus dem Speisesaal. Macht also insgesamt noch drei. Drei fitte, jugendliche Killermaschinen, deren wohlgestyltes Äußeres darauf schließen lässt, dass sie sich ein paar Mal zu oft Matrix angeschaut haben. Nicht zu vergessen der für sein Alter noch erstaunlich fit wirkende Gabriel.
Auf Utopia-Seite befindet sich nur noch Saphire und Bastian im Raum. Und natürlich ich... der unfreiwillige Beobachter in diesem bizarren Bruderkrieg.
„Wir waren gerade dabei, die gute alte Zeit wieder aufleben zu lassen.“, erklärt Gabriel seinem alten Bekannten.
Bastian grinst bitter.
„Du kannst einfach noch immer nicht vergeben, was, Gabriel? Aber... du bist doch sicherlich nicht gekommen, um hier eine Geschichtsstunde abzuhalten... hab ich Recht?“
„Natürlich nicht.“, erwidert Gabriel kalt, ohne seinen Blick auch nur für den Bruchteil einer Sekunde von Bastian zu nehmen.
Er macht eine kleine Pause, bevor er andächtig fortfährt.
„Drei Sprengstoffanschläge in den letzten Wochen... und jedes Mal waren die Gebäude längst geräumt, bevor die Bombe detonierte. Ein fehlgeschlagenes Attentat auf den bayerischen Innenminister... und einer meiner Jungs, der jetzt dafür in Untersuchungshaft sitzt. Deshalb bin ich hier! Und, um in Zukunft weitere Einmischungen von dir und deiner... deiner lachhaften Waisenknaben-Organisation in unsere Angelegenheiten ein für alle mal zu unterbinden!“
„Für deinen Jungen tut es mir leid.“, antwortet Benja gelassen. „Aber wie ich euch kenne, werdet ihr irgendeinem Richtersohn das rechte Ohr abschneiden, und er ist wieder frei. Du verstehst nur leider immer noch nicht, dass es auf diese Art und Weise nicht funktioniert! Mit Gewalt erreicht ihr nur, dass für friedliche Anarchisten wie uns das Leben immer schwerer wird.“
„Mit Gewalt erreichen wir, dass sich die Herren Regierenden zur Abwechslung mal mit den Folgen ihrer Politik konfrontiert sehen!“, rechtfertigt sich Gabriel. „Sie können ihre Autorität nicht mehr wirklich genießen... und das ist es, was wir als Erfolg für uns in Anspruch nehmen wollen. So naiv, zu glauben, dass man mit Gewalt mehr als das erreichen könnte, sind wir nicht. Wir sind schließlich keine Nazis.“
„Naja, viel fehlt nicht mehr.“, murmelt Saphire verächtlich... worauf ihm Asrael drohend seine geballte Faust entgegenstreckt.
„Überleg dir, was du sagst, Saphi!“
„Immer drohen, Gewalt, Terror... hast du denn in all den Jahren so wenig dazugelernt, Gabriel?“, fragt Bastian kopfschüttelnd.
Als Antwort starrt ihm Gabriel eindringlich in die Augen.
„Ich habe gelernt, dass Feinde viele Gesichter haben können.“
Bastian schaut deprimiert an ihm vorbei.
„Schade, dass du noch nicht gelernt hast, dass auch Freunde viele Gesichter haben können.“
Gabriel grinst. Dann dreht er sich um... sein eindringlicher Blick fällt auf mich.
„Wie ich sehe, habt ihr mal wieder Nachwuchs bekommen.“, meint er spöttisch. „Ist ja keine besonders spektakuläre Erscheinung... aber naja, das sind wir von eurem neuen Utopia ja schon gewohnt.“
„Lass den Jungen in Ruhe! Er hat mit uns nichts zu tun.“, erklärt Bastian. „Er ist bloß ein willkommener Gast hier. So wie jeder, der ohne Knarre in der Hand hier auftaucht.“
Gabriel scheint das offensichtlich überhaupt nicht zu gefallen.
„Ach, bloß ein Gast? Soll mich das jetzt beruhigen oder was?“, zischt er verächtlich. „Vielleicht ist es ja ein Spitzel der Polizei...“
„Komm schon, Gabriel. Die Gestapo gibt es schon längst nicht mehr.“
„Ich weiß...“, giftet Gabriel zurück. „Weil ich mitgeholfen habe, diese Typen nach dem Krieg unter die Erde zu bringen! Aber die Volksseele vergisst, Hitlerjunge. Genau wie damals. Und neue Übeltäter wachsen ständig nach... wohl auch, weil ihre Vorgänger offensichtlich nicht hart genug zur Rechenschaft gezogen wurden.
Also, wer ist der Pisser?“
„Ich bin der Sheriff von Nottingham!“, platzt es empört aus mir heraus. „Ich wurde entführt, hier her verschleppt, und muss mir jetzt den Anblick zweier zankender Greise antun... Es missfällt mir außerordentlich, dass man in euren Kreisen anscheinend nur den zu Wort kommen lässt, der eine großkalibrige Waffe mit sich führt. Ich schlage vor, wir ändern von nun an die Spielregeln...“
Gabriel verzieht amüsiert sein Gesicht.
„Der Pisser fängt an, mir zu gefallen.“, lacht er.
„Und... was schlägst du den Erwachsenen also vor, Notti?“, hakt Asrael herablassend nach.
„Dafür, um unsere Meinungsverschiedenheiten bei einer Tasse Tee und einem gemütlichen Joint zu klären, ist es nämlich schon lange vor deiner Geburt zu spät gewesen! Also würde ich sagen, du unterbrichst diese Diskussion unter Männern nicht länger und verhältst dich so still, wie es sich für ein jugendliches Entführungsopfer gebührt.“
„Ich denke ja gar nicht daran!“, erwidere ich. „Ich schlage euch vielmehr einen Handel vor: Ihr wollt, dass endlich eine Entscheidung fällt... und ich will hier nicht länger das Gefühl haben, nur darauf warten zu müssen, bis mir einer von euch eine Knarre ins Gesicht hält und abdrückt. Also... nehmt mich als unparteiischen Schiedsrichter, und bereinigt euren Zwist ein für alle mal, und zwar ohne faule Tricks... egal, von welcher Seite aus.“
Gabriel sieht mich herablassend an.
„Pah... da könnten wir ja gleich irgendeinen Passanten von der Straße nehmen. Welche Referenzen hast du denn schon vorzuweisen? Warst du mal im Krieg?“
„Nein, ich war nicht im Krieg.“, erwidere ich gereizt. „Aber ich glaube, mich als einen Mann von Ehre bezeichnen zu können. Versteht ihr, was das bedeutet? Ich habe kein Diplom, keine großen Reichtümer und keine so schicken Mäntel wie ihr... aber wenn es darum geht, fair zu sein und eine instinktive Ahnung davon zu haben, was falsch und was richtig ist, dann macht mir so schnell keiner was vor.
Ich frage mich: Wie wollt ihr euch anmaßen, darüber zu entscheiden, was für die Welt gut oder schlecht ist, wenn ihr es nicht einmal schafft, vor einem einzigen aufrechten, unbefangenen Menschen zu bestehen?“
„Da ist zweifellos was dran.“, meint Bastian nachdenklich an Gabriel gewandt. „Was ist... willst du überhaupt noch der Welt dienen? Oder hast du dir endlich deinen langen Traum erfüllt und bist zur Hyäne geworden, die nur noch ihrem Hunger dient?“
Gabriel schüttelt deprimiert den Kopf.
„Nein, Hitlerjunge... bis zur Hyäne habe ich es nie geschafft. Ich töte immer noch mit moralischem Überbau.“
Er legt eine kurze Denkpause ein, dann schaut er mir prüfend in die Augen.
„Du hast Mut und scheinst dich nicht so schnell einschüchtern zu lassen. Das gefällt mir! Vielleicht habe ich mich ja in dir getäuscht...“
„Also?“, frage ich gespannt. „Machen wir es jetzt auf meine Art?“
„Ich weiß nicht... was denkst du darüber, Asrael?“
Der Rotschopf wirft mir einen unfreundlichen Blick zu.
„Mit der Beute ein wenig zu spielen, bevor man sie vernascht, steigert den Genuss. Ich sage: Lass ihn so lange Schiedsrichter sein, bis er sich verausgabt hat und ihm keine Argumente mehr einfallen... dann erschießen wir alle und gehen nach Hause.“
„Du hast es gehört, Sheriff!“, meint Gabriel nachdenklich in meine Richtung gewandt.
„Akzeptierst du diese Bedingungen oder willst du gleich sterben?“
Ich muss auf einmal an MacGyver denken. Der wird grundsätzlich in jeder Folge am Ende in eine Hütte, einen Lagerraum oder irgendein Kellergewölbe eingesperrt. Ein normaler Mensch hätte keine Chance, da jemals wieder rauszukommen. Aber nicht MacGyver. Denn MacGyver ist anders als andere Menschen.
Ich bin auch anders, in gewisser Weise... wenn ich auch nicht gerade durch handwerkliches Geschick glänzen kann. Ob mir die zusätzlich rausgeschundenen Minuten am Ende irgendwas nützen werden, weiß ich natürlich nicht...aber nur so lässt es sich wohl erklären, dass ich auf den wenig verlockenden Vorschlag eingehe und mich nicht sofort von den üblen Burschen massakrieren lasse.
MacGyver gibt mir Hoffnung.
„Ich akzeptiere. Aber ich muss natürlich darauf bestehen, dass man mir zuerst den Rest der Geschichte erzählt!“, antworte ich entschlossen. „Also, Asrael war gerade dabei, mir zu berichten, wie ihr euch mit diesem Shlomo in der Kneipe getroffen hattet. Was ist dann danach passiert?“
Gabriel wirft Bastian eine auffordernde Geste zu.
„Erzähl du es, Hitlerjunge. Ist ja schließlich dein großer Auftritt gewesen...“
Der alte Terrorist lässt sich gemütlich neben Asrael auf einen Stuhl fallen, und bittet auch Bastian höflich, aber bestimmt, sich zu setzen.
„Aber sei so gut und mach es kurz, damit sich meine Jungs nicht all zu sehr langweilen müssen.“
Bastian überlegt eine Weile, offensichtlich den richtigen Einstieg suchend... dann beginnt er mit andächtiger Stimme zu reden.
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 12 - Schlechtes Karma
„Ich wusste längst nicht mehr, was falsch und was richtig war. Das lange Dahinvegetieren im Krankenhaus und später auf den Straßen der Großstadt hatte mich verändert.
Mädchen, Freunde, Fußballspielen... Dinge, die mir früher einmal ziemlich viel bedeutet hatten, waren mir völlig gleichgültig geworden. Ob ich alleine in einer engen Zelle saß, oder an der Seite von Gabriel anderen Menschen den Tod brachte... es ließ mich alles völlig kalt.
Was Benja wohl dazu gesagt hätte, mich in einem solchen Zustand zu sehen?
Vermutlich hätte er sich an mir festgekettet und tage- und nächtelang lustige Geschichten erzählt... bis ich wieder lachen konnte. Aber Benja war nicht mehr hier.
Mir wurde klar, dass es so nicht mehr lange weitergehen konnte.
Ich wollte nach Hause gehen. Noch einmal die Luft atmen, die ich damals mit Benja geatmet hatte... sehen, was aus meinen Eltern und meiner Schwester geworden war... und all den vertrauten Plätzen der Kindheit einen Besuch abstatten, die mir so weit weg erschienen, als sei es nun schon Jahrzehnte her, dass ich einmal dort gewesen war.
„6 Tage, Hitlerjunge!“, rief mir Gabriel beim Fortgehen noch zu. „Du hast 6 Tage Zeit, deinen Arsch wieder hierher zu bewegen. Sonst wird die große Abrechnung ohne dich stattfinden.“
„Ich scheiß auf dich, Gabriel.“, murmelte ich, ohne mich noch einmal zu ihm umzudrehen.
„Wir sehen uns am Staudamm!“, hörte ich noch Gabriels eindringliche Stimme, bevor ich wütend die Tür zuknallte.
Einen Staudamm zu sprengen... was für eine beknackte Idee! Als ob es noch nicht genügend Katastrophen auf der Welt geben würde. Für mich stand jedenfalls fest, dass er diese Aktion ohne mich durchführen musste.
Während der Zugfahrt nach Hause bemühte ich mich, eine zeitlang nicht mehr an Gabriel und seine großen Pläne zu denken.
Vor mir bauten sich fremde Landschaften auf... die flachen Felder gingen allmählich in eine hügligere Umgebung über, bis in den Mittelgebirgen sogar richtig steile Felsen und gebirgsähnliche Schluchten an meinem Fenster vorüberzogen.
Wenn ich daran denke, wie sehr mich eine solche Bahnfahrt noch vier Jahre zuvor gefesselt hätte... jetzt starrte ich nur teilnahmslos in die Landschaft hinaus, ohne mich auch nur ein kleines bisschen dafür zu interessieren.
Auch die im Abteil nebenan spielenden Kinder nahm ich kaum wahr. Mir gingen vielmehr Bilder von strammstehenden, streng dreinschauenden Erwachsenen durch den Kopf, die eine Fahne anbeteten und sich dabei gegenseitig an Gehorsam und Spießigkeit zu übertreffen versuchten. Fast ein wenig geschockt dachte ich daran, dass sie alle einmal fröhlich lachende Kinder gewesen sein mussten... genau wie die, die jetzt neben mir im Zug saßen.
Wie war das möglich? Wie konnte eine so hoffnungsvolle Saat so dermaßen verkommen?
Die letzten paar Kilometer ging ich zu Fuß.
Mit jedem Schritt, den ich tat, wurde mir die Umgebung vertrauter. Aber egal, was ich auch betrachtete... Vögel, Pflanzen, oder auf der Straße vorbeikommende Menschen... ich konnte kein Leben darin erkennen. Als ob ich durch eine Halle voller ferngesteuerter Roboter laufen würde.
Ich erreichte den Ort meiner Kindheit... das, was ich einmal Heimat genannt hatte. Doch ich war nur noch ein Fremder hier. Meine elegante Kleidung, mein Spazierstock, die ungewöhnlich langen Haare und meine düsteren Gedanken... alles an mir war zu anders, als dass es in dieses kleine Bauerndorf hätte hineinpassen können.
Vor Benjas Haus blieb ich stehen.
Ich sah in den Garten... blickte auf die vielen bekannten Plätze, die einmal so voller Leben und glücklichem Kinderlachen gewesen waren. Jetzt lag eine dicke Laubschicht auf der Holzbank... das Gartenhäuschen, in dem ich mich mit Benja oft versteckt hatte, schien zu Brennholz für den Winter verarbeitet worden zu sein.
Ich wollte schon weitergehen, als sich mir aus dem Gartentor langsam eine stämmige, ein wenig verunsichert dreinblickende Gestalt näherte.
Es war Benjas Vater. Vorsichtig kam er näher... seine Augen schienen sich an mir festzuklammern, die Lippen in dem faltigen Gesicht bebten. Er musste in den letzten Jahren stark gealtert sein.
„Bastian?“, fragte er.
„Du bist es... hab ich recht?“
Ich nahm meine Melone ab und strich mir die Haare aus dem Gesicht, damit er mich besser erkennen konnte.
„Was.... was ist mit Benja? Ist er...“
Ich nickte.
„Er ist... im Krieg gefallen.“
„Im Krieg.“, flüsterte sein Vater leise. „Dieser verdammte Krieg... wir waren alle so dumm. Ich verfluche diese Nazi-Verbrecher, die meinem Sohn eingeredet haben, dass er für sein Vaterland zu kämpfen hat... Er hatte doch genauso wenig Ahnung wie wir anderen auch. Er war noch so jung...“
Fast schien der stattliche Mann weinen zu wollen, doch er beherrschte sich. Ich kam langsam näher... er sollte nicht denken, dass Benja als sinnloses Kanonenfutter gestorben war.
„Sie haben sich in ihrem Sohn getäuscht.“, stellte ich leise klar. „Benja hatte schon länger als ich, sie, oder jeder andere in diesem Dorf geahnt, was für ein Irrsinn in unserem Land regierte. Er starb als Held... durch seinem Mut hat er einigen unschuldig Verfolgten das Leben gerettet.“
Die Augen seines Vaters weiteten sich.
„Dann... dann war er also ein Held.“, flüsterte er erleichtert. „Ich hätte es wissen sollen... aber ich, ich habe ihn meistens nicht ernstgenommen.“
Hinter uns öffnete sich die Haustüre, und eine Frau mit einem Baby auf dem Arm schaute neugierig heraus. Offensichtlich hatte der Typ auf seine alten Tage noch einmal geheiratet.
„Hat er von mir gesprochen?“, fragte er aufgeregt. „Hat er doch sicher, oder? Was hat er gesagt?“
Ich blickte ihm mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung in die Augen.
„Ach, das Übliche...“, erklärte ich ruhig. „Dass er sie niemals wieder sehen will, dass er ihre Schläge satt hat... ja, ein paar mal hatte er sich sogar gewünscht, sie wären tot. Aber...“, fügte ich rasch hinzu, bevor Benjas Vater etwas erwidern konnte, „aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben ihn nie als gleichwertigen Menschen betrachtet... immer nur als einen jungen Hund, der dressiert werden musste.“
Der Alte wischte sich verschämt eine Träne aus dem Gesicht.
„Ich war wohl kein guter Vater, auch wenn ich mir das immer wieder eingeredet habe.“
Ich sah mit einem leichten Lächeln auf den Lippen zu seiner Frau und dem Kleinkind herüber.
„Sie können Benja nichts mehr geben. Aber sie können es beim nächsten Mal besser machen! Seien sie ihrem Kind ein guter Freund, kein strenger Führer. Denn ich glaube, Führer hatten wir in diesem Land schon genug.“
Er nickte mir dankbar zu... dann setzte ich bedrückt meinen Hut auf und verabschiedete mich von ihm.
Meine Mutter und meine Schwester freuten sich natürlich übermenschlich, als ich auf einmal in meinem früher so geliebten Elternhaus auftauchte. Leider konnte mein Großvater das nicht mehr miterleben. Er war im letzten Kriegswinter an einer Lungenentzündung gestorben. Mein Vater wurde immer noch vermisst... ob er bloß in Gefangenschaft geraten oder gefallen war, konnte keiner so genau sagen.
Natürlich musste ich erst einmal erzählen, wie es mir in der Fremde ergangen war, und weswegen ich damals überhaupt so sang und klanglos verschwunden bin.
Ist es nicht seltsam? Wenn ein Kind von zuhause ausbüchst und nach zwei Tagen zurückkommt, wird es wahrscheinlich angeschrieen und kriegt den Hintern voll. Wenn es aber erst nach einigen Jahren wiederkommt, danken sie alle ihrem Gott und liegen sich glücklich in den Armen.
In den folgenden vier Tagen versuchte ich, mich wieder langsam an ein normales Leben zu gewöhnen, in dem andere Dinge im Mittelpunkt standen als Bomben, geheime Unterschlüpfe und Repressalien.
Es sollten vier Tage werden, in denen unglaublich viele Erinnerungen hochkamen... Erinnerungen, die ich schon für immer verloren geglaubt hatte.
Nachdenklich betrachtete ich die Bank in unserem Garten. Benja und ich hatten sehr oft darauf gesessen. Ich erinnerte mich an eine ganz bestimmte Nacht... es war, kurz nachdem mein Vater einberufen worden war. Traurig schaute ich in den klaren Sternenhimmel hinauf.
„Weißt du... ich glaube, er wollte gar nicht gehen.“, murmelte ich leise vor mich hin. „Er sagte, es sei seine Pflicht. Aber er hat dabei geweint.“
„Verrückte Welt.“, erwiderte Benja kopfschüttelnd. „Mein Alter hätte was weiß ich was dafür gegeben, den Bolschewisten in den Hintern treten zu können. Aber wegen seinem kaputten Bein haben sie ihn nicht genommen. Jetzt sitzt er fast nur noch zu Hause rum und meckert.“
„Würdest du da hin wollen? In den Krieg?“
Benja verzog sein Gesicht zu einer grimmigen Schnute.
„Du weißt doch, als ich mal beim Spielen auf den rostigen Nagel getreten bin. Das hat höllisch weh getan... ich frage mich, wie es sich erst anfühlen muss, wenn einem eine Kugel die inneren Organe zerfetzt. Ich bin mir sicher, dass ist nichts, worum man sich reißen sollte.“
Er starrte eine Weile übelgelaunt auf den Boden. Doch dann blickte er wieder zu mir auf und lächelte.
„Ehrlich gesagt... ich will für überhaupt niemanden kämpfen, den ich nicht persönlich kenne. Unser verehrter Führer mag vielleicht den Durchblick haben, was Politik und Strategie angeht. Aber... ich kann mit ihm nicht hier sitzen, meinen Arm um ihn legen und in die Sterne schauen. Verstehst du? Das kann ich nur mit dir. Daher wärst du auch der einzige Mensch, für den ich mich jemals abknallen lassen würde.“
Ich sprang hastig auf und rannte davon. Über die Felder, bis zum nahen Wald... weg von meinen Erinnerungen. Weg von der Erkenntnis, dass ich die beste Zeit meines Lebens schon längst hinter mir hatte.
Doch es half nichts. Die Bäume erzählten Geschichten. Jeder verfluchte Strauch am Wegrand schien mir eine neckische Anekdote aus meiner glücklichen Kindheit zuflüstern zu wollen.
Als ich an dem kleinen Waldsee ankam, in den ein morscher Holzsteg ragte, auf dem ich mit Benja oft genug gelegen war, ließ ich mich kraftlos am Ufer auf den Boden fallen.
Es war an einem Sommertag... wann genau, vermochte ich nicht mehr zu sagen. Benja und ich waren lange im Wasser gewesen, und hatten es uns jetzt auf dem Steg gemütlich gemacht, um uns von der Sonne trocknen zu lassen.
Verträumt beobachtete ich, wie die Wassertropfen auf Benjas weicher Haut allmählich kleiner wurden. Er gefiel mir schon damals... auch wenn wir uns immer nur so weit näher kamen, wie es die geltenden Moralvorstellungen erlaubten. Den Rahmen dessen, was möglich war, schöpften wir aber voll aus. Irgendeinen Grund fand man schließlich immer, einander zu berühren, zu massieren oder sich eine kleine Rangelei zu liefern, bei der man aufeinanderliegen konnte.
„Was gibt’s denn da zu glotzen?“, fragte mich Benja schelmisch. „Ich schau doch auch nicht viel anders aus als du, oder?“
„Keine Ahnung. Von hinten sehe ich mich so selten.“, entgegnete ich trocken. „Außerdem finde ich die kleinen Härchen an deinen Beinen irgendwie niedlich.“
Benja hob den Kopf und lachte mich an.
„Niedlich? Ich werde dir schon zeigen, wie niedlich ich bin!“
Mit diesen Worten stand er auf, packte mich und stürzte zusammen mit mir in das trübe, aber erfrischende Nass. Wir drückten uns gegenseitig mit den Schultern ins Wasser, fassten uns an den Händen, oder versuchten, abzutauchen und einander die Hosen herunterzureißen.
Es tröstete mich, dass ich noch rechtzeitig den Mut aufgebracht hatte, Benja zu küssen. Vermutlich hätte ich mir sonst noch wesentlich mehr Vorwürfe gemacht.
Verdammt... ich frage mich, wie oft Menschen, die total ineinander verschossen sind, achtlos aneinander vorbeileben, nur weil sie es nicht auf die Reihe bekommen, einander ihre Gefühle zu gestehen?
Wie viele Hitlerjungen mögen heimlich so gefühlt haben wie wir?
Wie viele moslemische Knaben denken heute beim Abendgebet in der Moschee nicht an Allah, sondern an ihren jugendlichen Nebensitzer? Immer mit der Gewissheit, dass man sie bei Bekanntwerden ihrer Gedanken steinigen oder vierteilen würde...
Oh, diese gottverdammten Konventionen! Ich verachte sie für all das, was sie auf der Erde angerichtet haben.
Religion, Rassenlehre, Nationalismus... egal, wie es sich nennt. Im Grunde ist es nichts anderes als ein erbärmlicher Ersatz für die große Liebe. Wer geliebt wird, der braucht keinen Führer und keine heiligen Bücher... der ist erleuchtet, auch ohne fünfmal am Tag zu beten oder einer auserwählten Herrenrasse anzugehören.
Vielleicht waren Benja und ich ja genau deshalb gegen die Ideologie der Nazis immun... weil wir uns hatten, und darüber hinaus eigentlich kaum noch etwas von Bedeutung war.
Als ich nach meiner Rückkehr vom See wieder zu Hause war und mich traurig in meinem Zimmer einschloss, erinnerte ich mich wieder daran, wie ich vor zwei Jahren die Masern hatte und tagelang das Bett hüten musste. Benja durfte wegen der Ansteckungsgefahr nicht zu mir nach oben kommen... aber selbstverständlich hatte er sich nicht daran gehalten und war heimlich durchs Fenster eingestiegen.
„Du wirst dich anstecken.“, murmelte ich schläfrig.
„Eben.“, erwiderte er leise und lächelte. „Dann bin ich genauso aussätzig wie du, und unsere Eltern können uns auch gleich zusammen ins gleiche Zimmer legen.“
Ich hustete stark, bäumte mich kurz ruckartig auf und lehnte mich danach vorsichtig wieder zurück.
„Benja... wenn ich jetzt sterben muss...“
„So schnell stirbt man nicht.“, unterbrach mich Benja beruhigend.
„Ja, aber wenn... zu wem würdest du dich dann in Zukunft ins Zimmer schleichen?“
Benja überlegte.
„Hmm... vielleicht zu irgendeinem schönen Mädchen?“
„Du würdest mich wohl gar nicht vermissen, was?“, fragte ich herausfordernd nach.
„Kaum.“, flüsterte er lakonisch zurück.
Dann sah er mich lächelnd an.
„Und weißt du auch, warum? Weil du immer mit dabei wärst! Bei jedem Fußballspiel, bei jedem Dorffest, bei jedem Fick. Ich kenn dich doch schon so lange, Basti... in dieser ganzen Zeit habe ich schon so viel von dir aufgenommen, dass du, so lange ich noch am Leben bin, gar nicht sterben kannst. Auch dann nicht, wenn deine Knochen schon längst in irgendeiner Grube vor sich hin faulen.“
Auf einmal wurde mir klar, dass das Ganze auch umgekehrt seine Gültigkeit hatte. So lange ich noch am Leben war, lebte auch Benja!
Langsam stand ich auf und ging zu der kleinen Kommode, in der Benja und ich immer unseren Krempel aufbewahrt hatten. Ich musste schmunzeln... alles lag noch genauso da, wie wir es damals zurückgelassen hatten.
Die Sporturkunden, unsere Lieblingsbücher, ein paar Zeichnungen, die Benja und ich einmal gemalt hatten, und verschiedene Propagandazeitschriften der HJ. Vorsichtig nahm ich eine davon zur Hand, um ein wenig darin herumzublättern.
Wie befremdlich das alles auf einmal wirkte... Hitlerjugend, Kinder in Uniform, Treueschwüre an den Führer. Als wären wir alle im Dornröschenschlaf gelegen, bis ein Prinz kam, um uns wachzuküssen...oder bis wir von einer Granate in Stücke gerissen wurden.
Mein Blick viel auf einen kleinen Artikel über Juden.
„Pest und Cholera – Wie die Juden im Mittelalter Brunnen vergifteten.“
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Die Juden, die ich kennengelernt hatte, waren anständige, sympathische Menschen gewesen, die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollten. Zum Beispiel die Leute aus dem Zirkus... keiner von denen hätte jemals einen Brunnen vergiften können.
Keiner?
Auf einmal stand mir der kalte Schweiß auf der Stirn. Entsetzt starrte ich auf die Zeichnung eines hakennäsigen Finsterlings, der irgendeine merkwürdige Flüssigkeit in einen alten Brunnen kippte.
„Der Staudamm...Gabriel hat überhaupt nicht vor, den Staudamm zu sprengen!“, schoss es mir durch den Kopf. „Er will an das Trinkwasser ran. Um etwas hineinzuleeren... die Lieferung des jüdischen Chemikers! Und dann...“
Was dann passieren würde, war klar. Eine ganze Region wäre dem Gift ausgeliefert. Und wenn das Mittel heimtückisch genug war, würde es sich erst dann bemerkbar machen, wenn schon Hunderttausende oder gar Millionen damit in Berührung gekommen waren.
Ich humpelte so schnell ich konnte die Treppe zur Wohnstube hinunter.
„Mama!“, rief ich im Lauf. „Ich muss dringend weg.“
„Was ist denn? Du bist doch gerade erst gekommen.“, erwiderte sie besorgt.
„Ich muss noch jemandem klarmachen, dass der Krieg vorbei ist. Aber ich komme wieder, versprochen! Also mach dir keine Sorgen.“
Ich küsste sie zärtlich auf die Stirn. Dann griff ich mir die Pistole, die ich die letzten Tage unter einigen dicken Wollpullovern in der Diele deponiert hatte, und eilte zum Bahnhof.
Die Sonne stand schon wieder hoch am Himmel, als ich endlich an dem großen Staudamm ankam, von dem Gabriel schon öfters gesprochen hatte.
Meine Beine schmerzten von der ganzen ungewohnten Anstrengung so sehr, dass ich mit jedem Schritt fürchtete, sie könnten mir abfallen. Dennoch kämpfte ich mich noch eilig eine steile, rostige Treppe hinauf, bevor ich schließlich am oberen Ende innehielt und mich erschöpft auf meinen Stock stützte.
Was auch immer Gabriel genau vorhatte... ich musste ihn aufhalten! Ich wischte mir mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, dann humpelte ich weiter.
Links und rechts von mir lagen einige Angestellte der Stadtverwaltung... tot, mit durchschnittener Kehle. Gabriel schien im Krieg völlig den Verstand verloren zu haben.
Endlich entdeckte ich ihn... umgeben von drei seiner Kumpanen, die gerade damit beschäftigt waren, mehrere große Fässer an der Brüstung des Dammes entlangzurollen.
„Da bist du ja, Hitlerjunge!“, rief mir Gabriel gutgelaunt entgegen. „Ich dachte schon, du kommst zu spät zur großen Wiedergutmachungsfeier.“
„Was ist das, Gabriel?“, fragte ich und deutete auf die rostigen Fässer. „Gift?“
Gabriel griff lässig in seine Jackentasche und zog einige bedruckte Blätter heraus, die er mir triumphierend in die Hand drückte.
„Kein Gift. Sondern ein biologischer Kampfstoff! Von Dr. Mengele persönlich in geheimen Nazilaboratorien entwickelt. Ich brauche dir sicher nicht zu sagen, an wem sie dieses Wundermittel damals getestet haben...“
Schockiert überflog ich die Tabellen und Zahlenreihen. Wenn mich meine Augen nicht täuschten, stand da, dass ein einziger Tropfen dieses Mittels ausreichte, um tausende Menschen innerhalb von 24 Stunden sterben zu lassen. Und Gabriel schien einige hundert Liter von diesem Zeug zu besitzen!
„Na, was ist? Beeindruckt?“
„Nein.“, erwiderte ich entschlossen. „Nur entsetzt über deinen Wahnsinn! Wie kannst du nur glauben, dass dadurch irgendetwas besser wird? Du wirst nur neuen Hass säen, nichts weiter.“
Einer von Gabriels Begleitern bückte sich hastig, um eine vor ihm am Boden liegende Maschinenpistole aufzuheben... doch ein gezielter Schuss von mir traf ihn in die Schulter und brachte ihn jäh zu Fall, bevor er sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte.
Dann richtete ich meine Waffe sofort auf Gabriel, um diesem keine Möglichkeit zu geben, irgendetwas Dummes zu tun.
„Sag deinen Leuten, dass sie von den Fässern weggehen sollen... sonst bist du in drei Sekunden tot!“, schrie ich aufgebracht.
Gabriel gab ihnen ein Zeichen, worauf sie sich einige Meter von den Fässern entfernt postierten. Dann blickte er mir verwirrt in die Augen.
„Verrätst du mir vielleicht jetzt, was das soll, Hitlerjunge? Hast du vergessen, was die Deutschen uns allen angetan haben? Sarah, Cäsar, Benja... denkst du, dass sie damit einfach durchkommen sollen?“
„Verdammt Gabriel... ich habe gar nichts vergessen! Aber anscheinend hast du vergessen, dass Benja und ich ebenfalls Deutsche sind. Ohne uns wärst du wahrscheinlich in Bragowizce draufgegangen. Und trotzdem willst du jetzt tausende Menschen töten... Menschen wie uns. Wäre ich nur ein paar Jahre später geboren, dann könnte ich einer derjenigen sein, die an deinem vergifteten Wasser krepieren müssen... Lässt dich das denn völlig kalt?“
Gabriel blickte melancholisch über das Geländer auf die glitzernde Wasserfläche.
„Ich weiß, dass es Unrecht ist, was wir tun werden.“, erwiderte er nachdenklich. „Ein großes, schreckliches Unrecht. Aber es muss getan werden. Die ganze Welt soll sehen, dass alle bösen Taten, die man tut, eines Tages doppelt und dreifach auf einen zurückfallen werden. Ein jeder Staatsbeamter muss sich in Zukunft darüber im Klaren sein, dass mit jedem Stempel, den er auf eine unmenschliche Anordnung aufdrückt, eines seiner Kinder stirbt.
Wenn die Menschheit nicht freiwillig erkennt, was richtig und was falsch ist, wird sie eben zwangszivilisiert. Und zwar hier und jetzt!“
Er gab seinen Leuten ein Zeichen, die daraufhin beide in ihren Hosenbund griffen.
Ich wollte drohend meine Waffe auf sie richten, doch da erkannte ich ein blitzendes Messer in Gabriels Hand.
In letzter Sekunde gelang es mir, aus dem Weg zu hechten... dann sauste der kalte Stahl auch schon wenige Zentimeter an meinen Ohren vorbei. Ich landete voll auf meinem kaputten Knie, das sich prompt mit einem knirschenden Geräusch bedankte.
Kurz vor mir schlug eine Kugel im steinernen Boden ein, wo sie eine staubige Wolke hinterließ. Ich wälzte mich zur Seite und feuerte in der Drehung auf Gabriels Männer.
Den ersten machte ich mit einem Schuss in die Hüfte kampfunfähig. Dann feuerte sein Partner erneut.
Er traf links von mir in die Mauer. Die Wucht des Schusses ließ unzählige kleine Steinchen durch die Gegend spritzen... irgendetwas davon erwischte mich am Auge.
Ich hielt mir schmerzerfüllt die Hand vors Gesicht und feuerte blind.
Ein gepresster Schrei, gefolgt von einem dumpfen Aufprallgeräusch, verriet mir, dass ich offenbar getroffen hatte. Dennoch feuerte ich noch einige weitere Schüsse auf die vor mir tanzenden Schemen ab, bevor sie endgültig aufgehört hatten, sich zu bewegen.
Dann richtete ich mich langsam auf. Da meine Beine nicht so wollten wie ich, schleppte ich mich mühsam am Geländer entlang zurück zu den Fässern.
Das grelle Licht der Sonne brannte schwarze Löcher in mein Sichtfeld... egal, wie sehr ich auch die Augen zusammenkniff, ich konnte kaum noch etwas erkennen. Das Blut, das immer noch aus der Wunde oberhalb meines Auges sickerte, tat sein übriges, dass ich beinahe blind wie ein Maulwurf war.
Weiter vorne bewegte sich wieder etwas. Es musste Gabriel sein, der eines der schweren Fässer alleine an die Brüstung zu rollen versuchte. Ich hörte das Kratzen des Blechs auf dem massiven Steinboden.
„Hör mir zu, Gabriel... 6 Millionen tote unschuldige Juden und 6 Millionen tote unschuldige Deutsche heben sich nicht gegenseitig auf. Verstehst du? Du hast am Ende keinen Ausgleich... sondern einfach nur 12 Millionen toter Unschuldiger. Jude, Deutscher... was macht das für einen Unterschied?“
„Niemand in diesem Land ist unschuldig!“, erwiderte Gabriel außer Atem, während er sich mit aller Kraft gegen eines der Fässer stemmte.
„Bauern, Hausfrauen, Arbeiter... sie alle haben das System unterstützt. Hätten die Bauern keine Milch mehr angeboten, wären die SS-Leute verdurstet. Hätten die Hausfrauen nicht mehr ihre Pflicht erfüllt, wären alle Nazis längst im Dreck erstickt. Ohne die Arbeiter hätte es keine Mauern und kein Stacheldraht gegeben, ohne die Stahlwerke keine Waffen, mit denen man Krieg führen konnte... und ohne die Bäcker und Metzger nichts, was die Naziverbrecher am Abend hätten essen können.
Jeder beschissene Händler, der ihnen ein rotes Stück Stoff für ihre Hakenkreuzflaggen verkauft hat, hat eine Mitschuld daran. Und jeder, der diesen Händler seinerseits mit irgendetwas beliefert hat! Kapierst du? Sie stecken alle unter einer Decke... Mörder und die, die sie bewirten.“
Ich versuchte angestrengt, das warme Blut aus meinem Gesicht zu bekommen. Doch es gelang mir nicht.
Schwankend hangelte ich mich weiter nach vorne... dabei mit der Pistole immer auf die Stelle zielend, an der ich Gabriel vermutete.
„Dann warst auch du schuldig, Gabriel... du hast die Wirte von Mördern mit deinen Messerwerfertricks unterhalten, damals im Zirkus. Wer weiß, wie viele überzeugte Nazis bei jeder Vorstellung im Publikum saßen. Und du hast ihnen den Tag versüßt...“
„Das ist nicht wahr!“, schrie Gabriel wütend. „Du weißt genau wie ich, dass wir uns mit Utopia so weit am Rand der Gesellschaft befanden, wie es nur möglich war. Weil wir die Gesellschaft abgelehnt haben!“
„Schuld haben in erster Linie die Nazis, Gabriel... nicht die einfache Bevölkerung.“, antwortete ich fast beschwörend. „Hast du eine Ahnung, wie schwierig die Lage für viele Menschen war? Sie waren auch nicht einverstanden mit allem, was die Nazis taten... aber sie sahen sich einer solchen Übermacht gegenüber, dass jeder Versuch, zu widersprechen oder sich mit anderen zusammenzuschließen, eine lebensgefährliche Mutprobe gewesen wäre. Du kannst nicht von jedem Menschen erwarten, dass er so selbstlos wie Benja in den Tod rennt... erst recht nicht, wenn er Familie hat, um die er sich kümmern muss, und wenn er zusätzlich noch den ganzen Tag mit Propagandascheiße und Lügen gemästet wird.“
„Ich erwarte, dass jeder Mensch die Zusammenhänge erkennt. Die Buddhisten sagen, dass wir durch böse Taten schlechtes Karma ansammeln...“
Er deutete fasziniert auf das große Fass in seiner Hand. „Das hier ist schlechtes Karma! Und anstatt umständlich zu warten, bis die Menschen reinkarnieren, zahle ich ihnen das, was sich durch ihre Taten angesammelt hat, schon gleich jetzt zurück.“
Ich war nur noch wenige Meter von ihm entfernt.
„Gabriel, jetzt hör doch mal zu: Ich gebe dir ja eigentlich in allem Recht. Aber überlege dir doch... was wirst du mit deinen Taten ernten? Was wird der Junge denken, der seine ganze Familie und all seine Freunde durch Gift im Wasser verloren hat? Durch Gift, das von Juden oder deren Sympathisanten dort hineingeleert worden ist? Er wird nicht verstehen, dass es ein Akt der Gerechtigkeit war.
Nein, für ihn wird es ein Grund sein, den Rest seines Lebens zu hassen. Was du hier vorhast, ist schlechtes Karma in die Welt zu kippen, obwohl du es genauso gut in einer Kiesgrube verscharren oder in die Luft sprengen könntest! Und damit schadest du letztendlich allen. Deinen Feinden, genauso wie deinen Freunden.“
Das Fass befand sich jetzt nur noch ein kleines Stück von der Stelle entfernt, an der das Geländer unterbrochen war. Im Prinzip genügte es nun, wenn Gabriel den Verschluss öffnete und es mit aller Kraft nach vorne wegstieß.
Und tatsächlich, er begann auch schon, eine der Sicherungs-Verstrebungen von dem Deckel des Behältnisses zu lösen. Ich schob hastig ein neues Magazin in meine Waffe.
„Hör sofort auf damit, Gabriel! Das ist meine letzte Warnung... tritt zurück, oder ich werde schießen.“
„Weißt du, dass ich... seit ich fünfzehn Jahre alt war, nur mit einem einzigen Menschen geredet habe?“, keuchte er. „Dieser Mensch bist du, Basti. Zumindest warst du es bis vor kurzem noch.“
„Wieso?“, fragte ich überrascht. „Wieso hast du bei mir eine Ausnahme gemacht?“
Gabriel öffnete die zweite Sicherung.
„Weil... weil jeder Mensch einen Freund braucht. So wie du und Benja. Der ist jetzt tot... was glaubst du, wird aus dir werden, wenn nun auch noch ich aus deinem Leben scheide?“
Jetzt fiel auch die dritte und letzte Sicherung, und Gabriel begann, vorsichtig den Verschluss aufzudrehen.
„Du wirst immer ein Teil meines Lebens sein.“, antwortete ich lächelnd. „Genau, wie Benja.“
Dann feuerte ich. Vier oder fünf mal. Dabei war alles, was ich sah, ein schwarzer Schatten, der von der Wucht der Geschosse nach hinten gerissen wurde. Als er sich hilfesuchend am Geländer festklammern wollte, gab ich entschlossen einen letzten Schuss ab.
Der Aufprall beförderte ihn über die Kante... dann stürzte er in die Tiefe. Lautlos, ohne einen Schrei oder ähnliches. Ganz so, wie ich es von ihm erwartet hatte. Elegant und geschmeidig bis zu letzt.
Erschöpft ließ ich mich vor dem Fass auf den Boden fallen. Ich hatte vielleicht gerade die freie Welt gerettet... aber niemand sollte diese Geschichte jemals gegen die Juden oder gegen die Idee von Utopia verwenden können. Daher schwieg ich viele Jahre über alles, was sich damals auf dem Damm ereignet hatte.
Eigentlich teilte ich es damals nur einem Offizier des US-Geheimdienstes mit, der selber Jude war, und dem ich vertrauen konnte. Er sorgte dafür, dass die Fässer ohne Aufsehen zu erregen abgeholt und entsorgt wurden. Dann ließ er meine Wunden behandeln und mich in einem Jeep nach Hause zu meiner Mutter eskortieren.
Mir war in jenem Moment einfach alles egal. Aber ich wusste, dass ich das Richtige getan hatte... und dass keiner meiner Freunde sterben würde, so lange ich noch am Leben war.“
Kapitel 13 - Gottesurteil
„Ja... weil deine Freunde sicherheitshalber eine kugelsichere Weste tragen.“, spottet Gabriel verächtlich. „Trotzdem brauchte ich damals Monate, um mich von meinen schweren Verletzungen zu erholen.“
„Oh, das bricht mir das Herz...“, erwidert Bastian kaltschnäuzig.
Ich trete einen Schritt nach vorne und schaue Gabriel streng in die Augen.
„Ich glaube nicht, dass es Bastian leicht gefallen ist, auf sie zu schießen... also wieso beschweren sie sich? Das, was sie am Staudamm tun wollten, war falsch!“
„Ja, das weiß ich ja alles selber.“, rechtfertigt sich der Alte. „Eine jugendliche Überreaktion... zwar verständlich, wie ich meine, aber ziemlich schlecht durchdacht.“
Sein Blick schweift an mir vorbei und trifft Bastian und Saphire.
„Doch ich bin nicht nur wegen der Sache von damals sauer auf Bastian. Nein... es geht vielmehr auch darum, dass er unsere Aktionen gegen die NRU und andere rechtskonservative Kräfte gezielt torpediert!“
„Weil sie genauso kontraproduktiv sind, wie alles, was du in den letzten 50 Jahren gemacht hast!“, regt sich Bastian auf. „Ich sag nur RAF. Das ganze war hirnrissig von vorne bis hinten. Am Ende hatten wir in der BRD den schlimmsten Polizeistaat seit Jahrzehnten... dank deinem Freund Baader und seinen studentischen Helfershelfern.“
„Wir haben Schleyer und vielen anderen gezeigt, dass sie einen Preis bezahlen müssen, wenn sie sich über andere stellen. Ist das etwa nichts?“, antwortet Gabriel gereizt. „Was hast denn du getan, während die meisten meiner damaligen Mitstreiter für ihre revolutionären Ideale in den Knast gewandert sind? Du hast deine Zeit damit vergeudet, um die Welt zu reißen und überall deine kleinen Utopia-Hippie-Kolonien aus dem Boden zu stampfen. Für was, frage ich mich? Für was?“
„Das hat einer Menge Menschen geholfen!“, mischt sich jetzt auch der sichtlich empörte Saphire in das Gespräch ein. „Utopia ist heute stärker, als es jemals zuvor gewesen ist. Wir können beinahe in jedes Land der Welt reisen... überall werden wir Brüder und Schwestern finden, die für das selbe eintreten wie wir!“
„Und wo sind eure weltweiten Kontakte jetzt in diesem Moment, hä?“, spottet Gabriel. „Ich sehe nur ein paar Kinder und einen alten Mann. Eure befreundeten Beduinenkrieger in Algerien können euch jetzt genauso wenig helfen wie die Bewohner des ehemaligen Waisenhauses in Usbekistan, aus dem ihr eine überraschend gut funktionierende Kommune gemacht habt. Und auf Goa zappeln nur noch ein paar durchgeknallte LSD-Leichen rum, die schon viel zu viele Gehirnzellen verloren haben, als dass sie sich noch an euch erinnern könnten.“
Bastian nickt anerkennend mit dem Kopf.
„Kompliment... Deine Informationen sind nicht schlecht. Du scheinst uns ja seit unserem letzten Treffen nicht mehr aus den Augen gelassen zu haben.“
„Das beruht ja wohl offensichtlich auf Gegenseitigkeit.“, erwidert Gabriel. „Verrate mir eins: Welcher von meinen Jungs spioniert für euch?“
„Was ist schon Spionage...“, antwortet Bastian gereizt, „Gegen einen heimtückischen gelegten Hinterhalt.“
„Was ist der kleine Hinterhalt gegen fünf Kugeln in meiner Brust? Gegen die Lächerlichkeit, der ihr die antifaschistische Brigade durch eure frühen Warnungen ausgesetzt habt? Man hält uns für zahnlose Tiger, die nicht viel zu Stande bekommen... außer vielleicht, einen psychisch gestörten Richter zu beseitigen.“
Bastian scheint an all dem nichts Bedauerliches erkennen zu können.
„Dank uns hält man euch für menschlicher, als ihr tatsächlich seid.“, erklärt er lächelnd.
Gabriel wird langsam ungeduldig. Wütend spuckt er vor seinem alten Freund auf den Boden.
„Ich spreche dir das Recht ab, meine Entscheidungen in Frage zu stellen! Sieh an, was du damit angerichtet hast... einer deiner jungen Mitstreiter hat eine Kugel abbekommen. Und dabei wird es nicht bleiben, wenn ihr uns nicht endlich in Ruhe lasst.“
„Wenn Jamiro stirbt, bist du dran!“, schreit Saphire wütend. „Dann werde ich dir dein verdammtes Messer eigenhändig in den Leib rammen...“
Drohend richtet Asrael seine Waffe auf Saphires Kopf.
„Na los, versuch es doch, du kleines Würstchen.“
„Jetzt haltet mal alle die Klappe!“, brülle ich so laut ich kann. „Könnt ihr euch nicht einfach gegenseitig verklagen... so wie es normale, zivilisierte Menschen tun würden?“
„Würdest du das denn tun, Sheriff?“, fragt mich Bastian nachdenklich.
Ich überlege einen Moment.
„Nein, vermutlich nicht.“, antworte ich. „Ich denke, ein Mann von Ehre sollte seine Probleme selbst lösen können, anstatt irgendwelche Anwälte damit zu beauftragen. Trotzdem... es wäre besser, wenn es irgendeine Instanz gäbe, die euch Streithähne zur Raison bringen kann. Sonst wird das hier noch in Mord und Totschlag enden.“
„Wir halten aber dummerweise nichts von Instanzen.“, giftet mich Asrael an. „Der Vorteil der Anarchie ist ja gerade, dass man für alles selbst verantwortlich ist, was man tut.“
„Das ist aber zugleich auch ihr größter Nachteil...“, antworte ich verärgert. „Drüben im Zimmer liegt ein junger Mensch, der jetzt tot sein könnte... und das nur, weil ihr euch niemandem außer euch selbst gegenüber verantworten müsst.“
„Falsch!“, erwidert Asrael. „Jamiro hat eine Kugel abbekommen, gerade weil ihn jemand dazu zwingen wollte, sich für etwas zu verantworten. Wir wollten euch nur eine Lektion erteilen... wenn die Bullen in diesem Land so schießwütig sind, ist das ja wohl nicht unser Problem!“
„Was sind die Menschen doch degeneriert...“, murmelt Gabriel und läuft langsam durch den Raum. „Ich meine... sie verkriechen sich alle hinter einer Armee von Uniformierten, wie ein Kind unterm Rockzipfel seiner Mutter. Keiner traut sich mehr, seine Konflikte selber auszutragen. Sobald es irgendwo Stress gibt, schreien sie gleich: „Hilfe, Polizei!“ Und dann kommen die Bullen und hauen mit ihren Knüppeln in die Menge. Ist das nicht pervers? Nicht selbst für seine Sache zu kämpfen, sondern anderen diese Aufgabe einfach zu übertragen? Das ist doch gegen die Natur...“
„Die meisten Menschen wollen eben mit Gewalt und Brutalität nichts zu tun haben.“, vermutet Saphire gereizt. „Im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten hier.“
„Nein, das ist nicht das Problem, Junge. Das Problem ist viel eher, dass die Menschen zu egoistisch sind, um noch in großen Sippen oder Familien zusammenzuleben, in denen jeder für den anderen einsteht. Sie wollen sich alleine durchs Leben schlagen... aber doch bitte ohne für ihr Leben auch selber kämpfen zu müssen. Sie sind maßlos gierig... wollen sowohl die Sicherheit der Gruppe als auch die Freiheit des Egoisten für sich in Anspruch nehmen. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Und dann fordern sie den starken Staat... weil sie erkannt haben, dass sie viel zu schwach und zu feige sind, um das Wagnis Leben tatsächlich alleine einzugehen.“
Interessante Theorie, denke ich bei mir. So etwas Ähnliches war mir auch schon mal in den Sinn gekommen.
„Aber...“, unterbreche ich Gabriel bestimmt. „Sagt, was ist mit den Schwachen, die weder kämpfen können noch eine Familie haben, die sie beschützt? Sollen die dann einfach draufgehen?“
Gabriel sieht mich überrascht an.
„Nun... um die sollten wir uns alle kümmern, findest du nicht? Aber tut das irgendjemand? Tut das etwa der Staat?
Bullshit! Hier, sieh dir meine Jungs an... sie waren am Ende. Junkies, Strafgefangene, Obdachlose. Niemand hat ihnen geholfen. Niemand. Das System hilft nur denen, die ihm wohlgesonnen sind... jedenfalls ganz sicher nicht allen, das kannst du mir glauben! Außerdem... das, was die Hilfe nennen, ist oft nur eine Hilfe, um zu funktionieren. Und keine Hilfe, um wirklich unbeschwert leben zu können.“
„Du hast ja Recht, alter Mann.“, entgegne ich verständnisvoll. „Da draußen läuft ne Menge schief. Und das vielgepriesene soziale Netz besteht größtenteils aus Stacheldraht... es fängt dich zwar irgendwie auf, aber besonders glücklich macht es dich nicht.“
Ich muss daran denken, wie ich monatelang Stammkunde auf dem Arbeitsamt war, weil ich wenigstens einen halbwegs erträglichen Job haben wollte. In gewisser Weise war auch ich hilfsbedürftig. Aber wurde ich geschützt und gepflegt, wie es einem die Ehre gegenüber einem Hilfsbedürftigen gebieten würde? Nein, wurde ich nicht! Ich war bloß eine Nummer... eine Nummer auf irgendeiner Liste. Und ich wurde auch genauso unmenschlich behandelt wie eine Nummer.
Ja, manchmal wollte ich diese Form von Hilfe am Liebsten mit einem lauten Knall in die Luft jagen... denn sie hat es einfach nicht verdient, sich „sozial“ zu nennen.
„Aber...“, entgegne ich entschieden, bevor der Eindruck entstehen könnte, dass Gabriel in mir einen neuen Verbündeten gefunden hat. „Es kann ja wohl keine Alternative sein, dass soziale Netz einfach ganz zu kappen, nur weil es zu unmenschlich ist. Die Leute, die heute zulassen, dass jemand auf Stacheldraht fällt, werden auch morgen kein Problem damit haben, dabei zuzusehen, wie dieser jemanden hilflos auf dem harten Steinboden aufschlägt.
Wäre es nicht besser, die alten Strukturen auszulachen und den Leuten Alternativen aufzuzeigen... so wie es Bastian mit seinen Jungs tut? Warum immer gleich drohend die Waffen auf jemanden richten?“
„Weil das Problem überhaupt nicht die veralteten Strukturen sind, sondern die Menschen an sich.“, sinniert Gabriel finster, der mich immer noch anschaut, als ob ich irgendetwas wahnsinnig Interessantes an mir hätte. „Ihr mangelndes Verantwortungsgefühl, ihr fehlender Stolz, ihre Bequemlichkeit. Manchmal scheint es mir, wenn man ihnen nicht von Zeit zu Zeit in den Arsch treten würde, würden sie sogar vergessen, dass sie atmen und am Leben sind.
Früher, in alten Zeiten... da wurden die Leute unterdrückt. Da wurden sie nicht gefragt, ob sie lieber mehr Söldner durch die Stadt patrouillieren sehen wollten, oder weniger. Heute werden sie gefragt... und viele entscheiden sich freiwillig dafür, mehr kontrolliert und mehr überprüft zu werden! Ich frage dich: Was, wenn nicht das, ist Degeneration?
Mir als stolzem Menschen, der sein Leben nie anderen unterordnen könnte, dreht es jedenfalls den Magen um, so etwas mit ansehen zu müssen. Wie sich manche Menschen klein machen, nur um es möglichst bequem zu haben. Ich könnte niemals mein Recht auf Selbstverteidigung in die Hände irgendeines Staatsdieners abgeben.“
„Das geht mir doch genauso, Gabriel!“, meldet sich jetzt wieder Bastian zu Wort. „Aber diesen Menschen ihre selbsterwählten Beschützer einfach abzuknallen, so wie du das tust, ist ja wohl auch nicht gerade eine Tat, auf die man stolz sein kann, oder?“
„Weißt du überhaupt, was du da sagst?“, herrscht ihn Gabriel wütend an. „Diese von dir verteidigten selbsterwählten Beschützer haben gerade einen deiner Jungs angeschossen... nicht, weil sie persönlich ein Problem mit ihm hatten, sondern nur, weil irgendjemand gesagt hat, es wäre ihre Pflicht. Entscheide dich endlich, auf welcher Seite du stehen willst, alter Narr!“
„Also gut...“, unterbreche ich die beiden mit einer beruhigenden Handbewegung. „Jetzt kühlen wir uns alle mal wieder ein wenig ab. Ich glaube, ihr habt im Lauf der Zeit vergessen, die vielen Gemeinsamkeiten zwischen euren Lebensweisen zu sehen... ihr seht nur noch die Unterschiede und den Hass.“
Ich schaue den beiden Kontrahenten eindringlich in die Augen.
„Gabriel... Utopia ist dir vielleicht zu friedlich, aber wenn du ehrlich bist, musst du dir eingestehen, dass du genau so immer leben wolltest... wenn du es nur könntest. Sonst wärst du schon damals nicht so lange bei dem Zirkus geblieben.
Bastian... auch wenn die antifaschistische Brigade einen Kurs eingeschlagen hat, den du nicht gutheißen kannst... vergiss nicht, dass sie im Grunde für das Gleiche kämpfen wie du.
Wenn ihr beiden wirklich meint, dass eine halbwegs zivilisierte Anarchie ohne gegenseitigen Mord und Totschlag möglich ist, dann habt ihr hier und jetzt die Chance, es mir und der Welt zu beweisen. Einigt euch!“
„Wir werden nicht von hier abziehen, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst.“, antwortet Asrael bestimmt.
„Und wir werden euch nicht in Ruhe lassen, weil wir kein Interesse daran haben, dass der Innenminister aufgrund eurer Terrorkampagne den Ausnahmezustand ausruft!“, erklärt Bastian. „Die Schweine da oben warten doch nur auf solche Gelegenheiten, um die Telefone der Bürger anzuzapfen, Ausländer auszuweisen und jeden Freidenker, der anarchistische Ideale besitzt, schikanieren und observieren zu können.
Wir sitzen hier auf gepackten Koffern... und weißt du auch, warum? Weil zu irgendwelchen dienstbeflissenen Verwaltungskreisen durchgesickert ist, dass hier eine nicht genehmigte Wohngemeinschaft existiert. Meine Kontakte im Rathaus haben mir gesagt, aufgrund der momentanen angespannten Lage könnten sie kaum etwas dagegen unternehmen, dass hier irgendwann eine Hausdurchsuchung stattfinden wird.
Es ist vielleicht nur eine alte Fabrikhalle. Aber verdammt, es ist unser Zuhause, Gabriel! Und wegen eurem Fanatismus müssen wir das jetzt wahrscheinlich aufgeben.“
Gabriel scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen.
„Ohne unseren Fanatismus... ohne Leute wie uns, die menschenverachtenden Abschaum aus dem Parlament schießen... würden wir heute alle noch wie in der Adenauer-Ära leben. Deine Kinder wären alle in irgendeinem katholischen Erziehungsheim untergebracht, und wenn sie sich mal wieder untereinander befummeln, würde man sie ins Zuchthaus stecken. Und dich wegen Kuppelei gleich mit! Ob es dir gefällt oder nicht: Bomben schaffen Freiheit!“
„Nur Freiheit schafft Freiheit.“, entgegnet Bastian unbeirrt. „Nimm dir alle Freiheit, die du in die Finger bekommst, und zeige der Welt, dass du damit umgehen kannst... und dass du nicht durchdrehst vor lauter Möglichkeiten, die sich dir offenbaren. Damit veränderst du in den Köpfen wesentlich mehr als mit deinen Bomben.“
Ich mache mir langsam ernsthaft Gedanken, wie das mit den Beiden zu einem guten Ende kommen kann. Ein Kompromiss müsste her... vielleicht ein Vertrag. Ein Abkommen.
Ich sehe eine Gruppe junger Anzugträger vor mir, die um einen riesigen Tisch sitzen und sich gegenseitig Tonnen von Papieren zum Unterzeichnen zuschieben. Nein... so würde das nicht funktionieren. Das wäre den Jungs von Utopia viel zu lebensfremd.
Es müsste nur ein einziges Papier sein... und niemand dürfte einen Anzug tragen! Dann würde es vielleicht schon eher funktionieren. Die Streitfrage ist ja eigentlich auch nicht besonders kompliziert. Sie lautet schlicht und ergreifend: Einmischung ja oder nein? Zumindest, wenn ich soweit alles richtig mitbekommen habe.
Ich verstehe Bastians Bedenken. Aber ich verstehe auch, warum Gabriel einen anderen Weg gewählt hat. Ich würde diesen Weg zwar nicht gehen wollen... aber im Zweifelsfall ist auch mir ein toter Richter lieber als die Vorstellung, dass harmlose Kiffer, Graffiti-Sprayer und notorische Schulschwänzer in Erziehungsheime oder Jugendknäste gesteckt und dort kaputtgemacht werden.
Auf einmal kommt mir eine Idee.
„Ich verrate euch, wie wir es machen!“, verkündige ich den anderen stolz. „In alten Zeiten wurde, wenn es keine andere Möglichkeit gab, einen Kompromiss zu finden, ein Gottesurteil einberufen. Ein Duell zweier verfehdeter Ehrenmänner... der Gewinner bekam Recht.
Das Ganze hatte natürlich den Nachteil, dass oft der bessere Kämpfer gewann, und nicht die Gerechtigkeit. Aber es gab auch einen ganz gewaltigen Vorteil: Jeder hatte eine Chance. Versteht ihr? Heutzutage sitzen Menschen machtlos wie Schlachtvieh auf der Anklagebank... die Hände in Handschellen, hinter ihnen eine Einheit schwerbewaffneter Bullen. Und das Einzige, was diese Menschen tun können, um sich zu verteidigen, ist freundlich zu lächeln und auf die Fähigkeit ihres Anwaltes vertrauen.“
„Ein Gottesurteil, hä?“
Gabriel lächelt. Offensichtlich scheint ihm die Idee sehr gut zu gefallen.
„Ja.“, nicke ich. „Zwei treten gegen einander an... und der Gewinner bekommt das Recht. Gewinnt Bastian, so werdet ihr von hier verschwinden und niemals wieder ungebeten hier auftauchen. Gewinnt dagegen ihr, so wird Utopia seine Spione abziehen und sich nicht mehr in eure Angelegenheiten einmischen.“
„Das klingt vernünftig. Auch wenn ich heute eigentlich etwas anderes vor hatte... aber ich denke, den Spaß werden wir uns doch noch gönnen. Also, was für eine Art Wettstreit schlägst du vor?“, fragt Gabriel.
Ich schau den beiden Alten fragend in die Augen.
„Mögt ihr Videospiele?“
„Videospiele?“, empört sich Asrael. „Hast du sie noch alle? Hier geht es um verdammt viel. Außerdem, wir sind diejenigen, die ihre Waffen auf euch gerichtet haben, schon vergessen? Daher schlage ich vor, es ist nur fair, dass wir uns die Art des Wettstreites aussuchen!“
Bastian nickt.
„Meinetwegen, tun wir es. Ich denke, es ist besser, als uns gegenseitig umzubringen.“
Ich sehe kritisch zu den anderen herüber.
„Ihr müsst mit eurem Ehrenwort dazu stehen, dass ihr die Entscheidung akzeptieren werdet, wie auch immer sie ausfallen mag.“, ermahne ich die Anwesenden.
Nach kurzer Beratung stimmen alle kopfnickend zu.
Dann richten sich die gespannten Blicke der Anwesenden auf Gabriel, der die Disziplin aussuchen soll.
„Wir entscheiden uns für den Faustkampf!“, verkündet dieser schließlich. „Der beste Kämpfer unseres Teams gegen den besten Kämpfer von euch. Verloren hat der, der zuerst aufgibt oder aufgrund von Tod oder eines anderen unerfreulichen Missgeschicks das Bewusstsein verliert.“
„Das geht nicht.“, antwortet Bastian verstimmt. „Wir sind hier nur in absoluter Notbesetzung vertreten. Jam und Saph sind verletzt, und die anderen sind eurem besten Kämpfer nicht gewachsen.“
Gabriel hebt seine Hand, worauf drei seiner Männer mit ihren Waffen auf Bastians Kopf zielen.
„Das ist mir scheißegal! Entweder, ihr nutzt die Chance, oder wir beenden das ganze jetzt auf unsere Art. Meine Kehle ist von diesem ganzen Gelabere schon staubtrocken... ich will endlich eine Entscheidung!“
„Warum kämpft ihr nicht?“, flüstere ich Saphire neugierig zu. „Eine bessere Chance bekommt ihr heute nicht mehr!“
„Dieser Asrael...“, erklärt mir Saphire. „Er hat in einem Jugendknast in Österreich einen Mithäftling mit bloßer Hand erschlagen, bevor er getürmt ist und von Gabriel aufgenommen wurde. Er ist ein verdammter Killer...“
„Richtig, ich bin ein verdammter Killer!“, faucht Asrael zu uns herüber. „Zu dumm nur, dass Jamiro verletzt wurde... er hätte garantiert nicht so feige den Schwanz eingezogen wie du, Skater-Ratte.“
„Also gut, wir machen es!“, entscheidet Saphire schließlich, nach einem kurzen Blick auf den immer noch zögernden Bastian. „Der beste hier befindliche Utopia-Kämpfer, gegen den besten Kämpfer der antifaschistischen Brigade. Wir werden das Ergebnis akzeptieren, egal, wie es auch ausfallen mag.“
„Na, das ist doch ein Wort.“, freut sich Asrael. „Auch wir werden das Ergebnis akzeptieren... das werden wir doch, Vater, oder?“
„Natürlich.“, bestätigt Gabriel. „Ich denke, Asrael wird mit Freuden unsere Gruppe im Kampf vertreten. Jetzt frage ich mich, wer auf Seiten von Utopia in den Ring steigen wird?“
Bastian und Saphire beginnen sich zu beraten.
„Chris hat ein schwaches Herz, das weißt du, Bastian... und Jamiro ist zu schwer verletzt.“
Darauf hatte ich gehofft.
„Ich werde für Utopia in den Ring steigen!“, erkläre ich selbstbewusst. Bastian nickt mir zu... er hat ja gesehen, zu was ich fähig bin, wenn mich etwas ankotzt.
Doch Asrael schüttelt unnachgiebig den Kopf.
„Nein. Du wirst nicht kämpfen! Du bist der Schiedsrichter. Die sollen einen anderen bestimmen!“
Verflucht! Warum macht er mir nicht die Freude und akzeptiert den Vorschlag? Schließlich war es doch meine Idee... wieso sollen sich andere dafür die Schnauze polieren lassen?
Saphire flüstert dem besorgt wirkenden Bastian irgendetwas zu, dann schaut er grimmig zu Asrael auf.
„Ich werde kämpfen!“
Asrael verzieht kritisch das Gesicht.
„Du? Du gehst mir nur bis zur Schulter und hast nen gebrochenen Flügel... das soll wohl ein Witz sein, oder?“
Doch Saphire lässt sich nicht beirren. Er tritt langsam zu einem von Gabriels Schergen und nimmt ihm dessen grüne Sonnenbrille von der Nase. Dann klopft er ihm auffordernd auf die Schulter.
„Gib mir deinen Mantel, ja?“
Widerwillig übergibt ihm der Typ das lange Gewand, das sich Saphire gleich darauf stolz überzieht... auch wenn es deutlich zu groß für ihn ist. Dann rückt er sich cool die Sonnenbrille ins Gesicht und geht herausfordernd vor Asrael in Position.
„Na los, Großer. Zeig, was du drauf hast!“
Ich beobachte, wie sich alle im Kreis um die zwei versammeln.
Für einen Moment glaube ich wieder, im Sherwood Forest zu sein. Der Sheriff von Nottingham ist Schiedsrichter bei einem Wettstreit zwischen den guten und den bösen Halsabschneidern.
Asrael, der arrogante Edelmann, gegen Saphire, den mutigen Jüngling. Ich meine beinahe, Pauken und Schalmeien erklingen zu hören... und die Rufe einer Menge, die die beiden lauthals anfeuert. Allmählich begreife ich: Das ist von vorneherein mein Schicksal gewesen. Ich gehöre hier her... an diesen Ort.
Langsam erhebe ich meine Hand, um den Beginn des Kampfes anzukündigen. Ich sollte mich zurücklehnen und den Moment genießen, an dem ich endlich ernstgenommen wurde... das erste Mal in meinem Leben, dass Menschen auf mich gehört haben, nur weil ich bin, was ich bin. Doch ich kann es nicht. Ich weiß, dass Saphire keine Chance haben wird.
Er lächelt mir mutmachend zu...
Dann trifft ihn auch schon der erste Schlag ins Gesicht.
Saphire prallt nach hinten und versucht sich zu fangen. Sofort setzt Asrael nach... er will seinen Gegner gar nicht erst zum Zug kommen lassen. Ein fieser rechter Haken gegen Saphs Backenpartie lässt dessen Sonnenbrille in hohem Bogen durch die Luft wirbeln. Dann holt Asrael erneut aus.
Doch sein nächster Schlag geht ins Leere. Saphire weicht geschickt aus, und schlägt mit seiner rechten Faust, so fest er nur kann.
Leider nicht fest genug. Asrael wehrt den Schlag lässig ab, in dem er Saphires Arm noch vor dem Aufprall am Handgelenk packt. Amüsiert beobachtet er, wie sich sein gehandicapter Gegner zu befreien versucht.
Dann greift Asrael mit seiner anderen Hand den unbeweglichen, eingegipsten linken Arm von Saphire. Er dreht ihn im Gelenk um, dass ein hässliches Knirschen zu vernehmen ist. Saphire geht mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Knie. Kurz darauf trifft ihn ein brutaler Fußtritt von Asrael mitten ins Gesicht.
Ich schaue angewidert auf den Blutschwall, der aus dem Mund des Jungen gegen eine der Wände spritzt. Nein, so habe ich mir das Ganze wahrlich nicht vorgestellt. Das ist kein fairer Wettstreit, sondern eine regelrechte Hinrichtung!
Saphire liegt mittlerweile völlig wehrlos am Boden. Verzweifelt hält er seine Hände vors Gesicht... doch das hindert seinen Gegner nicht daran, weiter unbarmherzig auf ihn einzuschlagen.
Ich balle meine Hand zur Faust. Wie gerne würde ich diesem unfairen Rotschopf zeigen, wie man wirklich kämpft.
„Halt, das genügt!“, ruft Bastian sichtlich um Fassung ringend. „Du hast gewonnen, Gabriel... lass uns dieses unwürdige Schauspiel beenden.“
Asrael hält inne und betrachtet keuchend das an seinen Fäusten klebende Blut. Ich sehe den am Boden liegenden Saphire, der den Kopf zur Seite wendet und erschöpft die Augen schließt.
Auf einmal überkommt mich eine wahnsinnige Wut. Wut auf mich selber, weil ich irgendetwas Gutes tun wollte, und mir keine sinnvollere Lösung eingefallen ist als ein archaisches Stammesritual zu veranstalten... genauso wie Wut auf die anderen, die anscheinend wirklich keinen besseren Ausweg wussten, als bei diesem Blödsinn auch noch mitzumachen.
Einige Zimmer entfernt befanden sich Kinder. Wahrscheinlich mittlerweile völlig verängstigt von dem Lärm und den dumpfen Schlaggeräuschen. Ein junger Mann lag mit einer Schussverletzung nebenan. Und wir taten so, als wäre eine dermaßen unfaire Prügelei eine zivilisierte Form der Konfliktbewältigung.
„Ja, beenden wir es.“, murmele ich leise. „Sonst kotze ich euch noch ins Wohnzimmer.“
„Lass es uns doch für immer beenden!“, erwidert Gabriel urplötzlich, und winkt einem seiner Männer zu, der daraufhin eine Pistole aus seinem Gürtel zieht und sie Bastian auffordernd in die Hand drückt.
„Ein Duell, Hitlerjunge. Nur du und ich! Der Gewinner überlebt.“
Bastian schüttelt ungläubig den Kopf.
„Das... ist doch Wahnsinn, Gabriel. Du bist nicht mein Feind... ich werde diese Waffe nicht gegen dich richten!“
„Na gut.“, erwidert Gabriel enttäuscht. „Wie du willst. Dann werde ich mich mal daran machen, alle unliebsamen Mitwisser in diesem Raum zu beseitigen.“
Er dreht sich zu mir um und wirft mir einen hasserfüllten Blick zu. Erschrocken weiche ich einen Schritt zurück, bis ich gegen einen der dort abgestellten Stühle pralle. Dann reißt Gabriel ruckartig seine Pistole nach oben.
Ich schließe die Augen. Ein lauter Knall lässt mich unwillkürlich zusammenzucken.
Als ich nichts spüre, schaue ich verwundert auf.
Vor mir liegt Gabriel am Boden... eine breite Blutspur fließt langsam unter seinem Körper hervor.
Bastian senkt niedergeschlagen den Revolver.
Niemand im Raum spricht ein Wort.
Nur ganz langsam erhebt sich Asrael, geht auf den Leichnam des alten Messerwerfers zu und nimmt ihm traurig die Waffe aus der Hand.
Dann richtet er sie ziellos an die Decke und drückt ab.
Klick. Klick.
Klick.
Kein Schuss löst sich.
Asrael wirft die Pistole vor Bastians Füßen auf den Boden.
„Sie ist nicht geladen... Keine unserer Waffen ist geladen. Nur deine!“
Bastian nickt, als ob er es geahnt hätte.
„Dann... war das Ganze also gar keine Racheaktion...“
„Nein.“, flüstert Asrael. „Es war nur der spektakulär inszenierte Abgang einer verlorenen Seele. Gabriel kam hier her, um zu sterben. Unsere Aufgabe war es lediglich, ihm ein würdiges Finale zu bescheren.“
Er seufzt leise und wischt sich verschämt eine Träne aus dem Gesicht.
„Ich hatte ihn vergebens darum gebeten, es nicht zu tun. Doch er war nunmal alt... und er wollte nicht irgendwann als tattriger Greis vom Verfassungsschutz abgeholt und in einen Knast gesteckt werden. Verstehst du das?“
Asrael schaut Bastian eindringlich in die Augen.
„Er wollte durch deine Hand sterben! So, wie es schon damals am Staudamm hätte geschehen sollen.“
„Aber... warum?“, fragt Bastian ratlos. „Warum diese ganze Scharade? Warum kam er als Terrorist, und nicht als Freund?“
„Hättest du ihn dann getötet?“, antwortet Asrael ernst.
Bastian schüttelt energisch den Kopf.
„Natürlich nicht! Wie könnte ich denn?“
Asrael tritt einen Schritt näher an ihn heran.
„Glaub mir, Hitlerjunge: Er hat dich nicht dafür gehasst, dass du damals auf ihn geschossen hast. Wenn er dich wirklich gehasst hätte, hättest du keine zwei Monate überlebt. Nein... er hat dich eigentlich sehr gern gehabt, die ganze Zeit über.
Was immer du auch denken magst... mein Vater war kein böser Mensch! Ich glaube, er hatte nur unter den falschen Bedingungen zu leben.“
Zögernd greift Asrael in seine weite Manteltasche, und zieht mehrere Seiten eines handgeschriebenen Abschiedsbriefes heraus.
„Das sind seine letzten Worte. Er hat mich gebeten, sie euch nach seinem Tod auszuhändigen. Er meinte, dann würdet ihr verstehen, dass es keinen anderen Ausweg für ihn gab.“
Gespannt geht Bastian auf den rothaarigen Jungterroristen zu. Er hält einen Moment lang inne... dann nimmt er ihm vorsichtig die Blätter aus der Hand und beginnt mit leicht zitternder Stimme daraus vorzulesen.
|
|
|
|
|
|
dian
unregistriert
 |
|
Kapitel 14 - Hunderennen
„Was ist das Leben?
Wie ein Köter beim Hunderennen jagen wir der vor uns herfahrenden Beute nach. Sie winkt uns zu, ruft uns, lockt uns. Und wir... wir rennen, weil wir glauben, dass wir, wenn wir unser Ziel erreicht haben, nie wieder rennen müssen. Was für ein Irrtum.
Wir sind Hunde. Zum Jagen geschaffen... und nicht, um mit der Beute zwischen den Pfoten ein glückliches Leben führen zu können. Sie wird uns immer wieder entrissen werden.
Schon als Kind fühlte ich, dass ich anders war als meine Mitmenschen. Ich erinnere mich, dass ich nachts oft einsam und alleine durch meine Heimatstadt streunte. Überall sah ich Häuser. Häuser, in denen Menschen lebten... größtenteils brave Menschen, die ordentlich arbeiten gingen, heirateten und ihre Kinder großzogen.
Aber ich... ich fühlte mich wie der Zauberer Gargamel in Schlumpfhausen. Überall waren diese kleinen blauen Wichte. Sie sangen, lachten und gingen mehr oder weniger fröhlich ihren täglichen Geschäften nach.
Ich hingegen beobachtete alles mit zunehmendem Unverständnis.
Wieso sich für ein schönes Leben abrackern, wenn man doch ohnehin sterben musste?
Wieso so tun, als wäre man schön und glücklich, obwohl man doch nur ein Haufen verrottendes Fleisch war?
Wieso ein beschissenes Schlumpfdorf bauen und darin leben? Tat man damit nicht genau das, was das Schicksal von einem erwartete?
Ich wollte dem Schicksal, Gott, oder was auch immer es da draußen geben mag, lieber ins Gesicht spucken! Ja... ich wollte mich hinstellen, und ihm wütend entgegenschreien:
„Danke für das Verfallsdatum auf den Lebensmitteln. Danke für einen Körper, den wir ständig füttern und versorgen müssen. Danke dafür, dass der Körper zu fett wird, wenn uns das Essen mal ausnahmsweise schmeckt und wir uns zu viel davon einwerfen.
Danke für die Fortschritte in der Medizin. Danke dafür, dass es Krankheiten gibt... sonst hätten wir ja gar keinen Grund, uns für die Fortschritte in der Medizin zu bedanken.
Danke für all die schönen Menschen. Danke, dass wir täglich unsere fleischgewordenen Sehnsüchte an uns vorbeilaufen sehen, aber nicht zugreifen dürfen. Danke dafür, dass uns unsere Moralvorstellungen nicht erlauben, einfach über sie herzufallen und sie zu vergewaltigen.
Danke für den flinken Plastikhasen, der immer greifbar nahe zu sein scheint... und der uns dadurch zu immer neuen Höchstleistungen anspornt. Ohne ihn wären wir ganz schön desillusioniert. Wir würden erkennen, dass wir zwar alle Wunder sehen, aber kein einziges davon jemals besitzen dürfen. Und dann... dann würde Schlumpfhausen in Flammen aufgehen!“
Mein Hass auf alles und jeden wurde zunehmend zerstörerischer.
Ich konnte nicht mehr viel Unterschied darin erkennen, ob ich einen Menschen tötete, oder ob ich ihn leben ließ und er dann irgendwann durch etwas anderes starb.
Wenn ich etwas besitzen wollte, nahm ich es mir. Ich benutzte es... und wenn ich genug davon hatte, zerstörte ich es. So konnte ich mir wenigstens einreden, dass ich es nur deshalb wieder verloren hatte, weil ich es selber so wollte... und nicht, weil mir der Hase mal wieder davongelaufen war.
Dann stieß ich auf den Zirkus.
Zunächst einmal fand ich es amüsant, wie sie sich verzweifelt darum bemühten, ihr Schlumpfhausen zu einem besseren Schlumpfhausen als alle anderen zu machen. Ein Leben ohne Zwang und Gewalt... schön und gut. Aber gewisse Zwänge konnten auch die Leute von Utopia nicht abschaffen. Den Zwang, etwas zu essen... den Zwang, seine Notdurft zu verrichten. Den Zwang, am Ende ihres zwanglosen Daseins zu sterben.
Aber sie machten im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste draus... das muss ich ihnen zweifellos zugestehen. Und insgeheim bewunderte ich Cäsar dafür. Auch, wenn ich ihm und den anderen nie so nahe kam, wie ich es vielleicht ein paar Jahre zuvor noch gerne gekommen wäre
Einzig mit Sarah verband mich etwas Besonderes. Vielleicht hätte ich sie lieben sollen. Wer weiß... möglicherweise hätte ich es ja noch getan. Irgendwann, wenn ich mich endlich mit der Vergänglichkeit des Lebens, dem ewigen Hunderennen, abgefunden hätte.
Aber diese Chance haben mir die Nazis nicht gegönnt.
Sie haben die letzte Hoffnung auf Rettung zunichte gemacht. Was soll ich sagen? Von da an kannte ich nur noch ein Ziel...
Ich dachte, wenn ich die Kontrolleure beseitige, der den ferngesteuerten Hasen auf der Rennbahn steuerten, dann wären die Hunde von ihrem stumpfsinnigen Leiden erlöst. Ich schoss, und schoss, und schoss... die Leichen stapelten sich im Kontrollraum regelrecht. Doch die Hunde waren nicht frei.
Zum einen wollten viele gar nicht frei sein. Sie konnten sich anscheinend gar nichts anderes vorstellen, als den ferngesteuerten Hasen zu jagen. Denn das war schließlich von klein auf ihr Lebensinhalt gewesen. Zum anderen waren da unabhängig von den Kontrolleuren noch die Mauern des Stadions... gewaltige, schon ewig lang existierende Bauten, die den Hunden gar keine Chance gaben, irgendwo einen rettenden Ausgang zu finden.
Ich verlor meinen Idealismus zusehends, denn ich musste erkennen, dass Waffen und Gewalt nur ein Teil des großen Befreiungsplanes waren... und dass ich die anderen Teile davon niemals kennengelernt hatte.
Das Einzige, was mir all die Jahre über Freude bereitete, war dieser einmalige Anblick: Einen Menschen, der harmlose und schwache Mitmenschen durch Gewalt zu irgendetwas zwingen wollte, am Boden liegen und um sein Leben winseln zu sehen.
Wisst ihr, wie mein Paradies aussieht?
In meinem Paradies besteht die gesamte Welt nur aus einem einzigen Raum. Ein nett eingerichtetes Zimmer... hinter dessen Wänden nichts mehr existiert. In diesem Zimmer leben eine Handvoll Menschen. Nackt, jeder ist den anderen schutzlos ausgeliefert.
Doch sie sind unsterblich... es gibt keine Krankheiten und keine bösen Überraschungen. Jeder, der seinen Blick einmal aufmerksam durch das Zimmer schweifen ließ, kann von sich behaupten, die komplette Welt gesehen zu haben.
Nach einigen Monaten weiß man alles von seinen Mitmenschen, kennt jeden noch so intimen Fleck. Nach einigen Jahren hasst man die anderen... man will aus der Welt ausbrechen, weil man das ewig gleiche Dahinvegetieren satt hat.
Doch nach einigen tausend Jahren ist man mit den anderen so sehr verwachsen, dass man sich als Teil einer Einheit betrachtet. Man hat jeden im Raum mindestens einmal gefickt, hat sich mit jedem im Raum einen blutigen Faustkampf geliefert... hat jeden im Raum einmal für seinen schlimmsten Feind und einmal für seinen besten Freund gehalten... hat mit jedem einmal gelacht und geweint, getrauert und gehofft. Alles nur eine Frage der Zeit, glaubt mir.
Die totale Harmonie... hervorgegangen aus totaler Hoffnungslosigkeit und der totalen Stagnation.
Wenn ihr jetzt sagt: „Was für eine beschissene Vorstellung! Ich will, dass meine Welt größer ist... dass ich unbekannte Landschaften erkunden, neue Leute kennenlernen und eine sinnvolle Aufgabe ausüben kann.“, dann hört auf, euch über euer Leben zu beklagen. Denn genau das habt ihr doch... Abenteuer, Nervenkitzel, Überraschungen.
Aber Harmonie? Die habt ihr eben nur bis zum nächsten Streit, bis zur nächsten Trennung, oder bis einer von euch stirbt... Stagnation ist euch schließlich ohnehin verhasst.
Ich hingegen habe diesen Frieden, der in der Stagnation liegt, mein ganzes Leben lang gesucht. Aber ich wurde nie fündig.
Die Zeit... ich hasse sie. Ich verachte sie. Sie ist grausamer als Adolf Hitler... unnachgiebiger als der schlimmste Diktator. Kalt und kompromisslos wie eine verdammte Tötungs-Maschine.
Ich kann den Deutschen verzeihen. Ich kann meinem Freund verzeihen, der fünfmal auf mich geschossen hat. Aber der Zeit... der Zeit werde ich nie verzeihen können. Denn sie ist sich keiner Schuld bewusst. Sie verspricht mir nicht einmal, in Zukunft nicht mehr so hartherzig zu sein. Sie verstreicht... und macht damit alle unsere Pläne zunichte. Erstickt jeden Idealismus, und macht alle Menschen gleich. Gute und Böse, Freiheitskämpfer und Nazis... sie lehrt uns: Es ist egal, wie du lebst. Am Ende stirbst du.
Ist das nicht beschissen?
Am Ende des Hunderennens wartet eine tiefe Schlucht, in die sie alle fallen werden. Die Schnellen, die Langsamen, die Schlauen, die Dummen. Alles wird wieder gleichgemacht.
Also wozu noch rennen? Wozu noch versuchen, irgendjemand oder irgendetwas zu sein?
Ich habe genug davon!
Schlechte Menschen wachsen schneller nach, als man sie erschießen kann. Menschen, die man liebt, sterben einfach so weg. Ich habe mir das jetzt beinahe 80 Jahre lang angetan... hab geglaubt, dass es irgendwann besser wird. Aber es wird nicht besser. Ich verfalle nur jeden Tag ein bisschen mehr.“
„Genug. Das reicht!“, schreit Asrael wütend und richtet die Waffe, mit der Gabriel erschossen wurde, erst ziellos auf die Leute im Raum, dann schließlich auf sich selbst. „Nennt mir einen einzigen Grund, warum ich in dieser Scheißwelt weiterleben sollte! Egal was wir tun werden... wir werden am Ende scheitern. So ist es doch, oder etwa nicht?“
„Eine gute Frage.“, murmele ich leise. „Eine verdammt gute Frage.“
Bastian, der mittlerweile über den verletzten Saphire gebeugt ist und ihn notdürftig verarztet, dreht sich zögernd zu uns um.
„Vielleicht ist es eine Art Wettstreit.“, flüstert er. „Gabriel hatte schon Recht. Das Schicksal spielt mit uns. Lässt uns Träume machen, die wir oft nicht erreichen können... Aber wer sagt denn, dass wir nicht genauso gut mit dem Schicksal spielen können?“
Er macht eine kurze Pause, um nach den richtigen Worten zu suchen.
„Stellt euch vor, die Hunde hören auf einmal auf, dem Hasen hinterherzujagen. Stattdessen setzen sie sich gemütlich in eine Ecke der Rennbahn und schließen nun ihrerseits Wetten darauf ab, wie viele Runden der Hase übersteht, bis es einen Kurzschluss gibt und das ganze verlogene Plastikgestell niederbrennt.
Ihr regt euch auf, dass der Hase nicht echt ist, und alle trotzdem wie blöd hinter ihm herhecheln? Dann freut euch doch darüber, dass ihr es gecheckt habt, und lehnt euch zurück! Niemand in unserem Land wird euch deshalb erschießen... auch wenn es manche vielleicht gerne tun würden.“
Asrael verdreht kritisch die Augen.
„Aber... dann würden uns alle als Verlierer bezeichnen.“, murmelt er frustriert.
Bastian horcht auf.
„Interessant... das klingt ja gerade so, als giertest du insgeheim doch noch nach dem falschen Hasen. Ein bequemes, erfolgreiches Luxusleben hätte ja schon seinen Reiz, nicht wahr?“
„Sieger zu sein hat seinen Reiz.“, korrigiert ihn Asrael. „Sieger zu sein und von niemandem mehr von oben herab betrachtet zu werden.“
„Ja, das ist klar.“, nickt Bastian einsichtig. „Verlieren will niemand. Aber seit doch mal ehrlich: Macht euch ein gutes Fußballspiel denn nur dann Spaß, wenn ihr gewinnt und der Beste seid? Also, ich erinnere mich... als ich früher mit Benja auf den Wiesen gekickt hatte, war es mir egal!
Ich versuchte alles, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Aber ich habe es nicht gespielt, weil ich es gewinnen wollte. Ich habe es gespielt, weil es mir mitsamt seiner vielen Niederlagen gefiel... weil die Situation so etwas Besonderes, Magisches an sich hatte. Der vom Abendrot in pastellene Farben eingetauchte Himmel, der Duft des frisch geernteten Grases, Benjas Lachen und seine Flüche, wenn ich ihn einmal ausgetrickst hatte... das alles war viel zu wundervoll, um allzu lange einem verschossenen Ball nachzutrauern.“
Ich schaue den Alten fragend an.
„Wie meint ihr? Sollen wir uns dann etwa freuen, wenn uns das Leben hin und wieder auf die Bretter schickt?“
„Sagt doch einfach: Ok, Schicksal. 1 zu 0 für dich.“, antwortet Bastian nachdenklich. „Und dann steht wieder auf, schüttelt euch den Dreck von den Kleidern und versucht es erneut. Ihr werdet vielleicht keinen großen Sieg davontragen... aber ihr werdet dem Schicksal immer wieder den einen oder anderen Punkt abluchsen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und am Ende...“
„Am Ende sind wir tot und das Schicksal hat das Spiel gewonnen.“, fällt ihm Asrael frustriert ins Wort. „Wir können das Spiel gar nie gewinnen... das ist es doch, was mein Vater gemeint hat. Was ist schon ein Punkt, wenn das Schicksal am Ende immer gewinnt?“
„Woher willst du das denn wissen?“, erwidert Bastian. „Woher willst du wissen, welche Seite am Ende gewinnt? Wenn du stirbst, ist einfach die Spielzeit zu Ende. Da ist noch nicht über die Punkteverteilung entschieden.
Außerdem... die Punkte sind doch nicht das entscheidende. Entscheidend ist, dass du am Ende sagen kannst: Ja, verdammt, dieses Spiel war geil!
Gewinner, Verlierer... glaubst du diese beschissene Propaganda von irgendwelchen Leuten im Nadelstreifenanzug, die sich hinstellen und lauthals verkünden: „So wie ich muss ein Gewinner aussehen!“ ?
Das ist doch Blödsinn, Junge! Gewonnen hast du, wenn du mit dir und dem, was du in deinem Leben angestellt hast, zufrieden bist. Wenn du auch noch in meinem Alter in den Spiegel schauen kannst und dennoch nicht viel Verachtenswertes an dir entdecken wirst. Wenn du Menschen um dich hast, die dich respektieren und lieben...“
„Ihr würdet euch also als Gewinner bezeichnen?“, frage ich, fasziniert von der Sicherheit, mit der Bastian gesprochen hat.
Bastian blickt stolz zu dem sich langsam aufrichtenden Saphire.
„Das ist ein Gewinner.“, meint er, und klopft ihm wohlwollend auf die Schulter.
Das beeindruckt mich.
Der junge Skater hat mächtig was abbekommen. Aber er lächelt schon wieder. Vielleicht kämpft er in ein paar Wochen wieder gegen Asrael... bekommt wieder einen auf die Schnauze. Aber er weiß, egal ob er oben auf ist oder am Boden liegt, er hat eine Familie, die immer hinter ihm steht. Er weiß, er hat es versucht... und er kann behaupten: „Es war ein großes Spiel.“
Saphire wird den Platz eines Tages als Sieger verlassen, da bin ich mir sicher.
Und ich?
Ich blicke fragend in die versammelte Runde hinein.
Ich habe verloren... damals, im Sherwood-Forest, dem Garten meiner Eltern, in dem unser Baumhaus stand. Ich habe verloren... auf dem Arbeitsamt, wo sie mir nur unwürdige Jobs vermitteln konnten.
Aber heute.... verdammt, heute habe ich gewonnen! Und das ohne mich sonderlich anzustrengen. Ich habe Juwelen gefunden. Menschliche Juwele, die so kantig, stark und glänzend sind, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.
Wer weiß... vielleicht bin auch ich für einen von ihnen ein solches Juwel.
Mir gehen die Worte von Cäsar durch den Kopf.
„Mit einem Mal siehst du, wie viel deine Träume wert sind... wie viel sie eigentlich die ganze Zeit über wert waren.“
Ja, er hatte zweifellos Recht. Jetzt sehe ich es! Und ich frage mich, warum ich so oft nur an die herben Enttäuschungen dachte, die ich mit meinen alten Freunden erlebt habe. Warum nicht an die vielen schönen Jahre, in denen wir einen wunderbaren Traum miteinander teilten?
Ich fühle: Genauso wie Benja immer bei Bastian sein wird, werden meine Erinnerungen an das, was mir wichtig ist, immer ein Teil von mir bleiben. Der Sherwood-Forest lebt in mir. Robin Hood lebt in mir. Und jetzt... jetzt glaube ich, lebt auch noch ein ziemlich großes Stück Utopia in mir.
Fickt euch, ihr Leute, die ihr mich für einen wertlosen Träumer haltet! Ich besitze einen Schatz, den ihr niemals finden werdet. Ein Licht, das mich durch mein Leben begleitet... das irgendwo in mir leuchtet, selbst wenn ich in noch so tiefer Nacht wandle.
Und das, ganz ohne in die Kirche gehen zu müssen. Mein Licht ist mein Leben. Meine gesamten Erfahrungen. Meine Träume. Meine Hoffnung. Und verloren habe ich bloß dann, wenn ich das Spiel nur noch spiele, um es zu gewinnen.
Ich schaue zu dem immer noch ziemlich angespannt wirkenden Asrael. Dann gehe ich langsam auf ihn zu.
„Entschuldige... aber hättest du vielleicht Interesse, ein wenig in die Vergangenheit zu reisen?“, frage ich ihn eindringlich.
Er sieht verwirrt zu mir rüber.
„Was laberst du da?“
„Na... ganz einfach.“, erkläre ich. „Ich kenne da ein altes Baumhaus, das schon lange von niemandem mehr benutzt worden ist. Und ich würde gerne... sehr gerne... wieder jemanden haben, mit dem ich dort sitzen und mir die Zeit vertreiben kann.
Das Problem ist nur... wie soll ich sagen? Die Welt ist voller vernünftiger Menschen, die sich beharrlich weigern, ab einem bestimmten Alter noch in ein Baumhaus zu steigen.“
„Was würde ich... dort finden?“, fragt der Rotschopf zögernd.
Ich lächele ihm vielsagend zu.
„Wahrscheinlich kein Hunderennen. Aber vielleicht ein Fußballspiel, wie es Bastian beschrieben hat. Einen erinnerungswürdigen Sieg, eine erinnerungswürdige Niederlage... vielleicht auch nur einen erinnerungswürdigen Sonnenuntergang.“
Asrael senkt langsam die Pistole und schaut mir fragend in die Augen.
„Wie wäre es, mit einem erinnerungswürdigen Stockkampf, Little John? Auf einem schmalen Baumstamm, der über einen Bach ragt... so etwas wollte ich nämlich schon seit ich ein Kind bin mal machen!“
„Ich bin nicht Little John.“, erwidere ich. „Little John sitzt im Knast. Ich bin der Sheriff. Und ja... ich hätte verdammt Bock darauf, dir, dem roten Ritter, heimzuzahlen, was er einem meiner befreundeten Lords angetan hat.“
Er wirft mir einen herausfordernden Blick zu. Dann sichert er seine Pistole und schiebt sie langsam in seine Gürtel zurück.
„Du wirst Baden gehen, Notti...“, spottet er, und setzt ein siegessicheres Lächeln auf.
„Täusch dich da nicht, Asra.“, antwortet Bastian amüsiert. „Der Sheriff hat einen verdammt harten Schlag drauf!“
Erleichtert stehe ich wenig später mit Saphire und Bastian vor Jamiros Bett.
Er ist bei Bewusstsein und reißt schon wieder Witze mit seinen Freunden. Noch immer fällt es mir schwer, die Ereignisse der letzten Stunden zu verkraften.
„Kompliment an dich, junger Sheriff.“, murmelt Bastian und nickt mir anerkennend zu.
Ich verstehe nicht ganz, worauf er hinaus will.
„Kompliment wofür? Ich war doch eigentlich nichts als ein Zuschauer. Die Prügel haben andere einstecken müssen.“
„Hast du ne Ahnung...“, erwidert Bastian. „Asrael ist keiner von der Sorte, der sich eine Knarre an den Kopf hält, nur um einmal im Mittelpunkt stehen zu können. Glaubt mir: er hatte ganz fest vor, abzudrücken. Keines meiner Argumente hätte am Ende geholfen, ihn davon abzuhalten.
Das konnte nur noch etwas Unvorhergesehenes... etwas, das ihn völlig aus dem Konzept brachte. Und das warst du und dein Mittelaltertick. Du hast ihn da vermutlich an einen Traum erinnert, den er vor langer Zeit selber einmal geträumt hatte.“
„Das war keine große Heldentat.“, entgegne ich nachdenklich. „Ich war nur zufällig der richtige Schlüssel für sein Schloss. Überschätzt ihr meinen Einfluss da nicht ein wenig?“
„Wir sind alles Spielfiguren in einem großen Wettbewerb. Jeder unserer Züge verändert nicht nur für uns etwas... er verändert vielmehr den Zustand des gesamten Spiels. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Einfluss auf andere. Warum nicht stolz sein, wenn es ein guter Einfluss war? Was kümmert es dich, ob du was dafür konntest oder nicht? Freu dich doch, dass du etwas bewirkt hast.
Ich gehe sogar noch weiter: Hättest du nicht deine Ausbildung geschwänzt und mich am Bahnhof getroffen, wer weiß... vielleicht wäre statt Jamiro Saphire mit mir nach Berlin gefahren. Und da der einen Kopf kleiner ist, hätte ihn die Kugel des Polizisten statt in die Leiste in die Eingeweide getroffen. Er wäre verblutet, ich hätte Gabriel nicht mehr zu Wort kommen lassen, sondern wäre ihm gleich an die Kehle gesprungen.... und am Ende wären ne Menge wertvoller Menschen tot in unserem Speisesaal gelegen.“
Ich schüttele ungläubig den Kopf.
„Nein... nein, also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.“
Bastian wirft mir einen strengen Blick zu.
„Schockiert es dich, wie viele Einflussmöglichkeiten ein jeder Mensch auf das große Spiel des Lebens haben kann? Aber so ist es! Ein jeder von uns ist von Bedeutung. In jeder Sekunde unseres Daseins. Ohne dich wäre die Welt nicht mehr die selbe. Ganz egal, wie unwichtig du auch zu sein glaubst.
Ein kleiner, kluger Mann hat einmal zu mir gesagt:
„Und selbst, wenn du denkst, dass du eine noch so große Niete bist... du bist doch immer wenigstens ein Statist im Film desjenigen, an dem du in der Stadt vorbeiläufst. Du bist Nebendarsteller für deine Arbeitskollegen oder Nachbarn... und, was viel wichtiger ist: Für dich selbst, und für deine besten Freunde, da bist du der Hauptdarsteller. Der Star! Egal, ob du schön bist, reich bist, Abitur hast... oder nichts von alledem.“
Mach dir das klar, Sheriff. Mach es dir klar, wann immer es irgendjemand da draußen in Zweifel ziehen will.“
„Bastian hat recht!“, mischt sich Saphire ein, der sich schon seit ein paar Minuten einen kühlenden Eisbeutel auf die Wange drückt.
„Du bist wichtig. Du hast unser Leben gerettet.“
„Vielleicht haben wir uns ja gegenseitig gerettet.“, antworte ich und setze nachdenklich die Sonnenbrille auf, die ich Asrael kurz zuvor abgeschwatzt hatte.
Bastian nickt mir anerkennend zu.
„Genau so sollte es doch eigentlich auch sein, oder?“
Epilog
Nach mehr als drei Tagen zusammen mit den Leuten von Utopia sitze ich wieder im Zug nach Hause. Müde, erschöpft... aber zum ersten Mal seit langem mal wieder so richtig zufrieden. Unglaublich, wie viel sich in den letzten Tagen alles für mich verändert hat. Wäre ich der jugendliche Held in irgendeinem klischeehaften Mainstream-Roman, müsste jetzt wohl von mir der Satz fallen: „Ich bin erwachsen geworden.“
Aber das ist Blödsinn. Ich habe nämlich gar nicht vor, erwachsen zu werden. Erwachsene bauen Atombomben, Konzentrationslager und Tellerminen. Wenn sich dagegen Jugendliche danebenbenehmen, werfen sie im schlimmsten Fall eine Fensterscheibe ein oder lassen eine Flasche Bier im Supermarkt mitgehen. Das ist mir irgendwie wesentlich sympathischer.
Ich beobachte Asrael, der jetzt etwas ziviler gekleidet ist und mit gegenüber sitzt. Er hat den Kopf nach hinten gelehnt und die Augen geschlossen... offensichtlich scheint er zu schlafen. Allerdings sehr unruhig. Ständig zuckt irgendein Muskel zusammen, die Hände hat er verkrampft ineinander gefalten.
Es wird wohl nicht einfach werden, diesen jungen Terroristen von Gabriels dunklen Rachegedanken abzubringen... ihm eine vernünftigere Alternative zu seinem bisherigen Leben aufzuzeigen. Aber ich will es versuchen. Einfach, weil ich weiß, dass es das Richtige ist... und dass, wenn ich keinen Erfolg haben sollte, ein ganzes Heer von Psychologen, Richtern und Irrenärzten schon begierig darauf warten wird, seinen Willen zu brechen, um ihn wieder zurück in die ihm zugewiesene Legebatterie stecken zu können.
So gesehen habe ich endlich einen Job, der mir zusagt, und der mir ziemlich wichtig ist. Auch, wenn mich niemand mit Geld dafür bezahlen wird... mein Gefühl sagt mir, dass der Lohn am Ende etwas ungleich Wertvolleres als ein Gehaltsscheck sein wird.
Bevor ich ging, hatte mich Bastian noch zur Seite genommen und mir ein paar Sätze mit auf den Weg gegeben, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Er meinte zu mir:
„Erinnerst du dich noch, als du gemeint hast, dass du ein hoffnungslos altmodischer Geist aus der Vergangenheit wärst? Das bezweifle ich, nach allem, was ich jetzt von dir weiß. Du bist nicht von gestern. Du bist einer von morgen. Und das Land deiner Träume liegt noch nicht hinter dir... es wartet vielmehr in der Zukunft auf dich!“
Ob ich irgendwann für immer in Utopia bleiben werde, weiß ich noch nicht. Es fällt mir schwer, mich an irgendetwas zu binden, was außerhalb meines Kopfes existiert. Vielleicht werden Asrael, ich und ein paar andere eines Tages unser eigenes Utopia aufmachen. Oder wir gründen eine Band und schreiben ein paar Songs... über Helden, die niemand kennt, und die bis heute in keinem Geschichtsbuch erwähnt werden. Wir touren durch die Lande, füllen ganze Hallen und bringen jeden Teenie dazu, für uns die Schule zu schwänzen, um etwas wirklich Vernünftiges zu lernen.
Klar, ich bin ein Träumer. Na und? Daran stören sich nur diejenigen, die nicht mehr träumen können. Mich stört es nicht im Geringsten. Und meine neuen Freunde auch nicht, soviel ist sicher.
Vielleicht sollte ich mir aber irgendwann einen anderen Namen aussuchen. „Notti“ klingt eher nach einer italienischen Gebäckspezialität, und „Sheriff“ passt nicht ganz zu dem Problem, das ich mit Autoritäten habe.
Ich schaue noch einmal auf den schlafenden Asrael, bevor dessen Gesicht vor meinen Augen mehr und mehr verblasst und mich das rhythmische Rattern des Zuges in einen tiefen Schlaf wiegt.
Einen Moment lang frage ich mich, wo ich wohl am nächsten Morgen aufwachen werde.
In dem engen, stickigen Zugabteil? Auf der Matratze neben Saphire? Oder gar zu Hause in meinem Bett?
Es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Denn egal, wo auch immer... eines steht für mich von heute an fest: Träumen ist so ziemlich das Vernünftigste, was wir tun können. Und selbst wenn ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt wäre, der von Utopia träumt... in dem Moment, wo ich an diesen Traum glaube, wird er zur Realität werden.
ENDE.
|
|
|
|
|
|
Hansi
unregistriert
 |
|
Sehr schön, ich hab ja schon viele Gerüchte darüber gehört, wenn ich Gegenwelt dann mal in gedruckter Form gelesen habe, dann les ich mir das danach auch mal durch.
|
|
|
|
|
|
|